Neues und Interessantes über uns und die Bestattungsbranche
Immer wieder gibt es Veränderungen bei uns im Unternehmen oder interessante Neuigkeiten aus der Bestattungsbranche, die für Sie nützlich sein könnten. Wir möchten Sie deshalb an dieser Stelle regelmäßig über diese Veränderungen informieren und Ihnen so einen bestmöglichen Einblick in unsere Arbeit geben.
Draußen hell und innen dunkel?

Bild: Adobe Stock #508215783 von Prashant
Gibt es ihn eigentlich überhaupt noch – den „Bildungsbürger“, der selbst im Halbschlaf fehlerfrei Goethes „Osterspaziergang“ deklamieren kann? Sie wissen schon: „Vom Eise befreit sind Strom und Bäche, durch des Frühlings holden, belebenden Blick …“ Weiter als bis zur ersten Zeile kommt in den Generationen der nach 1960 Geborenen kaum noch jemand. Eigentlich schade, denn die gute Frühlingslaune mit etwas Kulturgut zu begründen, macht nicht nur Eindruck bei Freunden, Kollegen oder Familienmitgliedern, sondern stärkt auch das eigene Ego.
Vor allen Dingen lässt es der Dichterfürst nicht bei diesen beiden Zeilen bewenden. Gleich die nächsten erklären schon, was der Frühling noch so mit sich bringt: „Im Tale grünet Hoffnungs-Glück; der alte Winter, in seiner Schwäche, zog sich in raue Berge zurück.“ Frühling ist Hoffnung, Winter das Vergehen. Allein: Schön wär’s!
Denn nicht jeder Frühling bedeutet für alle Menschen Hoffnung: Er kann auch eine Zeit sein, die dunkler ist, als es der kälteste Winter sein könnte. Wenn Hoffnungslosigkeit und Trauer den Frühling überschatten, weil ein geliebter Mensch verstorben ist, helfen die ersten wärmenden Sonnenstrahlen kaum gegen die Dunkelheit im Herzen.
Es der Natur gleichzutun und neue Kraft zu schöpfen, ist ein Prozess, der Zeit benötigt. Psychologen erklären, dass Trauerbewältigung individuell verschieden abläuft. Manche Menschen vollziehen diesen Schritt leichter und schneller, für andere ist die Zeit fast endlos. Hilfestellung durch Bücher, Trauergesprächsgruppen oder professionelle Trauerhelfer vermitteln alle Bestattungsunternehmen gern. Aber auch viele Krankenkassen sind Ansprechpartner für Hinterbliebene. Auf solche Unterstützungsangebote zurückzugreifen, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern im Gegenteil ein Ausdruck rationaler Entscheidungsstärke: Denn so wie die Sonnenstrahlen dem Körper wohltun, braucht auch die Seele etwas Wärme.
Ein Grund für schlechte Laune?

Bild: Adobe Stock #309625290 von splitow27
Der Jahreswechsel? Schon fast vergessen. Weihnachten? Ach ja, da war doch was. Der Speck auf den Hüften, den das gute Leben im Dezember hinterlassen hat? Ja, der ist noch da.
Abzunehmen und gesünder zu leben, ist einer der häufigsten Vorsätze, den Bundesbürger anlässlich eines neuen Jahres fassen. Wie so vielen anderen ist auch ihm nur selten ein Erfolg beschieden. Laut Erhebungen von Statista wird nur rund ein Viertel der gesteckten Ziele im Februar noch verfolgt. Das Ergebnis: Frustration und Ärger angesichts des eigenen Scheiterns. Der schier endlos scheinende Winter mag ebenso seinen Teil dazu beitragen, dass die Menschen dünnhäutiger sind als im zweiten Monat des Jahres.
Wenn es gleich mehrere Ursachen gibt, die uns die Laune verderben, hilft die Hoffnung auf bessere Zeiten nur bedingt. Erst mal müssen die aktuellen Misslichkeiten ausgeräumt sein, bevor die gute Stimmung wieder Überhand gewinnt. Die allfälligen Ärgernisse des Februars sind dann noch die harmlosesten, gehen sie doch entweder vorbei oder werden zum Sommer erneut in Angriff genommen, um die perfekte Strandfigur zu erlangen.
Wesentlich schwieriger zu bewältigen sind Situationen, die nicht einfach vorübergehen – weil sie endgültig sind. Der Verlust eines Angehörigen ist eine der schlimmstmöglichen Erfahrungen. Sie zu verarbeiten, fällt allen Hinterbliebenen schwer. Allerdings: So wie es eine clevere Entscheidung ist, zum Bekämpfen des Weihnachtsspecks die Unterstützung eines Fitness-Trainers zu suchen, lohnt es sich auch, in Sachen Trauer Profis zurate zu ziehen. Erfahrene Trauerhelfer helfen dabei, Gewicht von der Seele zu nehmen. Und ebenso wie Sie Ihr Fitness-Studio meist durch Empfehlung finden, können Sie auch für Ihr seelisches Work-out immer einen guten Tipp erhalten – ganz einfach bei Ihrem Bestattungsunternehmen.
Ein Tag wie jeder andere?
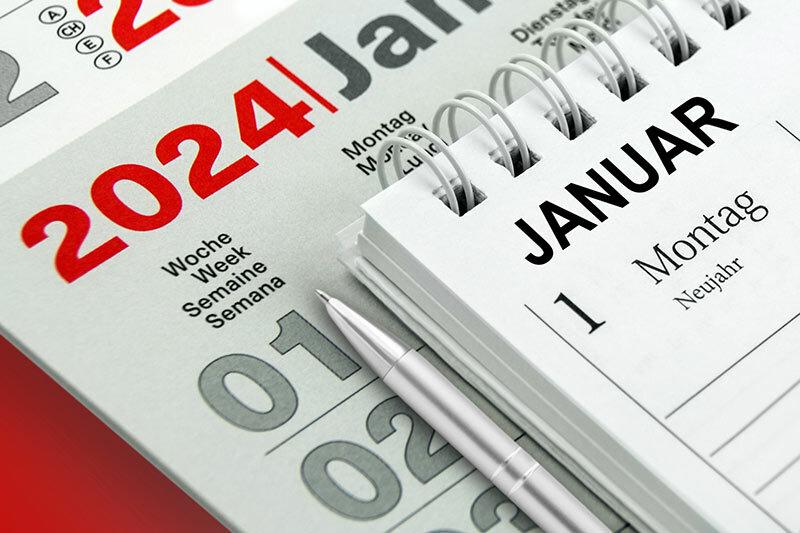
Bild: Adobe Stock #661456083 von PhotoSG
Und auf einmal hat ein neues Jahr begonnen: Wir alle blicken in die Zukunft, manche mit Optimismus, andere eher sorgenvoll. Zunächst aber fühlt sich der 1. Januar nicht anders an als der 31. Dezember – sofern man nicht am Silvesterabend den alkoholischen Erfrischungen eine Spur zu freudig zugesprochen hat.
In dieser Hinsicht ist ein kalendarischer Jahreswechsel nichts anderes als ein Geburtstag – nämlich ein Tag wie jeder andere. Trotzdem sind solche Momente eben doch ein sichtbares Zeichen für das Voranschreiten der Zeit. Zeit, die jedem Menschen Tag für Tag kürzer wird, da das Leben unweigerlich seinem Ende entgegenschreitet. Für manche Menschen wird 2024 ein gutes Jahr werden, für andere ein weniger glückliches. Und leider werden – wie in jedem Jahr in Deutschland – rund eine Million Menschen sterben. Das ist die durchschnittliche Anzahl der Sterbefälle laut Statistik.
Für die Hinterbliebenen wird es nicht einfach sein, Hoffnung und neuen Mut zu finden. Man mag sich sagen, dass an jedem Tag und in jedem Jahr unzählige Menschen dieselbe Situation durchleben – Trost findet in dieser Erkenntnis wohl niemand. Jeder Sterbefall betrifft einen individuellen Menschen – das wissen Hinterbliebene ebenso wie Bestatter, Seelsorger und Trauerhelfer. Die Einzigartigkeit jedes Sterbefalls macht der Statistik zum Trotz diese Tage im traurigsten Sinne des Wortes unvergesslich.
Umso mehr lohnt es sich also, schöne Tage gleichfalls im Gedächtnis zu behalten: sei es der eigene Geburtstag oder eben der jüngst erlebte Silvesterabend – selbst wenn Sie sich an ihn mit Kopfschmerzen und einem flauen Magen erinnern.
Wir wünschen Ihnen und den Ihren ein glückliches neues Jahr – bleiben Sie gesund!
Wenn Weihnachten kein Grund zum Feiern ist

Bild #382983901 von Halfpoint - stock.adobe.com
Romantik allenthalben, der Duft von Zimt und gebrannten Mandeln liegt über der Stadt, Glöckchen klingeln und festliche Lieder schallen aus den Lautsprechern – oder Gassenhauer von Bing Crosby oder Wham! Das mag man mögen oder nicht, entkommen kann man Weihnachten kaum.
Man muss kein professioneller Griesgram sein, um der Weihnachtszeit mit Vorbehalt zu begegnen. Wenn andere im Familienkreis feiern, ist das Alleinsein doppelt hart – ganz besonders, wenn es noch neu ist, weil im Laufe des Jahres 2023 ein Ehe- oder Lebenspartner, ein Elternteil oder ein anderes Familienmitglied verstorben ist.
Dann ist Weihnachten ungewohnt und oft genug sehr traurig. Nicht jedem ist es gegeben, über die Feiertage in die Südsee zu entfliehen oder bei einem alten Klassenkameraden Asyl zu finden. Der Gedanke, nicht der einzige Mensch in Deutschland zu sein, der diese Situation durchzustehen hat, ist kaum tröstlich, weist aber dennoch einen Weg, um die vermeintlich schönsten Tage des Jahres zu verkraften. Denn überall finden sich gerade an den Festtagen Hinterbliebene zusammen, um gemeinsam Weihnachten zu verbringen – und nach Möglichkeit eben doch etwas Freude zu finden.
Zahlreiche Kirchengemeinden und soziale Einrichtungen bieten spezielle Weihnachtsfeiern für Alleinstehende an. Auch per App lassen sich Gleichgesinnte treffen, beispielsweise per „Spontacts – Aktivitäten und Events“ oder „GemeinsamErleben“. Beide Apps sind kostenfrei für Android und iOS verfügbar. Grundlegende Hilfe in allen Trauersituationen gibt es online bei der Evangelischen Kirche unter trauernetz.de. Eine weitere Anlaufstelle ist die Telefonseelsorge: Sie ist 24 Stunden am Tag gebührenfrei und anonym unter den Telefonnummern 0800-1110111 und 0800-1110222 erreichbar.
Endlich November!

Bild: #130748303 von fisher05 - stock.adobe.com
Das Leben erwacht, die Blumen beginnen wieder zu sprießen, die Sonne lacht vom Himmel und die Menschen entdecken in sich gute Laune. All das, was den Frühling ausmacht, lässt der November vermissen. Draußen ist es kalt, feucht und schlichtweg trist. Das kann auch der unverwüstlichsten Frohnatur die Stimmung nachhaltig vermiesen.
Aber dennoch – selbst in diesen Tagen lassen sich Gründe für Optimismus finden. Die nahende Weihnachtszeit ist nur einer davon, die Aussicht auf gemütliche, romantische und lange Abende am Kamin ein anderer und der Besuch auf dem Friedhof der dritte.
Wer nun zusammenzuckt und einen Friedhofsbesuch als das möglicherweise deprimierendste Erlebnis des Jahres ansieht, sollte einen Gedanken an den oder die Menschen aufbringen, die dort ruhen. Vielleicht sind es Oma oder Opa, vielleicht ein Elternteil, ein Bruder oder andere Verwandte. An diese Menschen zurückzudenken, tut fast immer gut, sich an schöne gemeinsame Erlebnisse zu erinnern, ein stilles „Du fehlst mir!“ zu sagen oder einen Strauß Blumen niederzulegen.
Diese Blumen, ein Kranz oder eine neu gepflanzte Staude sind im Trauermonat November ein wichtiger und liebevoller Gruß an einen unvergesslichen Menschen. Zwischen Allerheiligen und Totensonntag besuchen wir die Friedhöfe, um Andacht zu halten und nicht zuletzt, um Gräber für die kalten Monate herzurichten. Es tut gut, für einen geliebten Menschen wieder einmal etwas Einsatz zu zeigen, und dieses Gefühl strahlt Wärme in die eigene Seele. Und etwas Wärme können wir alle in der kalten Jahreszeit schließlich ganz besonders gut brauchen!
Zeit für einen Waldspaziergang

Bild: #176984252 von Piotr Krzeslak - stock.adobe.com
Tief einatmen und die feuchte, klare Luft mit ihrem Duft von Laub und Erde genießen und zuschauen, wie die Sonne durch das gelbe Blattwerk bricht: Nirgends zeigt sich der Herbst von einer schöneren Seite als im Wald.
Das Laub strahlt in Orange-, Braun- und Rottönen, und das Erdreich, auf dem sich die fallenden Blätter sammeln, wird getränkt von Morgentau und Regenschauern. Es ist eine beruhigende Umgebung, die gerade jetzt von vielen Spaziergängerinnen und Spaziergängern besonders genossen wird. Manche haben ihren Hund dabei, andere einen Feldstecher, in der Hoffnung, ein Reh auf einer Lichtung zu erspähen, die nächsten tragen vielleicht einen Rucksack mit einem Stullenpaket und Getränken bei sich, und wiederum andere werden im Wald von Erinnerungen und tief empfundener Dankbarkeit begleitet.
Denn der Wald ist ein Ort der Ruhe, der Kraft gibt und zum Innehalten einlädt. Und ein Ort, um hier die ewige Ruhe zu finden. Naturbestattungen unter den Wipfeln der Bäume sind eine Alternative zum Friedhof, die von immer mehr Menschen bevorzugt wird.
Die Gründe sind vielgestaltig. Denn neben der Ruhe stiftenden Natur des Waldes sind es auch ganz pragmatische Überlegungen, die eine Baumbestattung attraktiv machen. Wenn eine Urne im Wurzelwerk bestattet ist, wird sie – je nach örtlichen Voraussetzungen – mit einer Plakette am Baumstamm oder auf dem Boden kenntlich gemacht. So haben Angehörige immer einen Anlaufpunkt bei ihren Waldspaziergängen, um an einem Grab Andacht zu halten. Mehr allerdings ist nicht von der Grabstelle zu erkennen. Weder das sonst allgegenwärtige Heidekraut noch aufwendig zu pflegende Stauden- und Blumenbepflanzungen sind vorhanden. Die oft mühsame Grabpflege entfällt für die Hinterbliebenen, weil sie von der Natur übernommen wird.
Informationen zu den Möglichkeiten einer Waldbestattung in der Region geben gerne die Fachleute der Bestattungsunternehmen. Ein Anruf oder Besuch lohnt sich also, bevor Sie bei Ihrem nächsten Spaziergang den Wald mit ganz anderen Augen erkunden werden.
2003 wurde dieses Fest zu Ehren der Verstorbenen von der
UNESCO zum Meisterwerk mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit erklärt und ist somit Teil des Weltkulturerbes.
Wir alle kennen mittlerweile Halloween, ursprünglich ein feierliches Totenfest, das von Irland über Amerika bis nach Deutschland getragen wurde. Mittlerweile ist die Verehrung der Verstorbenen jedoch dabei eher abhanden gekommen. In Deutschland ist “Allerheiligen” am 1. November der traditionelle Feiertag des Gedenkens.
Der “Día de los Muertos“ wird ins Deutsche wortwörtlich als “Tag der Toten” übersetzt und entstand aus der Vermischung der ursprünglichen Gedenkfeierlichkeiten einheimischer Mexikaner (z.B. Azteken) und dem Glauben europäischer Eroberer im 16. Jahrhundert.
Bis dahin feierten die Einheimischen ihr Totenfest, das seit ca. 3000 Jahren existiert, wo es einen ganzen Sommermonat über gefeiert wurde. Im Rahmen der Bekehrungsabsichten der katholischen Eroberer wurden die Feierlichkeiten auf den 1. und 2. November gelegt, was den christlichen Feiertagen Allerheiligen und Allerseelen entspricht.
Die mexikanischen Ureinwohner sahen den Tod als einen Teil des Lebens an.
Am “Día de los Muertos“ sollen die Toten dem Glauben nach für einen Tag wieder auf die Erde kommen, um dort mit ihren Verwandten und Freunden wiedervereinigt zu werden.
Am ersten der beiden Feiertage, dem “Día de los Inocentes“, wird den verstorbenen Kindern gedacht und ihre Gräber werden dazu mit weißen Orchideen geschmückt. Am 2. November, dem “Día de los Muertos“, wird den Erwachsenen gedacht, deren Gräber mit orangefarbenen Ringelblumen verziert werden.
Damit die Toten den Weg zu ihren Angehörigen finden, müssen dafür Vorkehrungen getroffen werden. An den Haustüren werden Laternen aufgestellt und leuchtende Ringelblumen werden von den Gräbern bis zur sogenannten “Ofrenda“ ausgestreut, damit der Weg für die Toten gekennzeichnet ist.
Die “Ofrenda“, vergleichbar mit einem Altar, dient dazu, den Toten Speis und Trank anzubieten. Auf dem Altar werden Fotos der Verstorbenen aufgestellt, Blumen und mit Blüten behangene Kreuze zieren den Tisch.
Das “Pan de Muerto“, ein süßes Brot, wird ebenfalls angeboten, denn Brot gilt als Symbol der Gemeinschaft der Lebenden und der Toten. Das mit Anis gebackene Brot wird außerdem mit Todessymbolen verziert.
Auch Süßspeisen, die in der Form der “Calavera Catrina“ gehalten sind, sind typisch für den Tag der Toten. “La Catrina” ist eine in Mexiko häufige Skelettdarstellung, die durch den Kupferstecher José Guadalupe Posada geschaffen wurde.
Zwar ist der “Día de los Muertos“ ein familiärer Feiertag, doch es finden auch große Feiern in Gesellschaft mit vielen anderen Menschen statt.
Für den Toten ist das umso ehrenhafter: Je mehr Menschen für einen Toten zusammenkommen, desto mehr Freunde hatte er zu Lebzeiten.
Um Mitternacht ist dann alles vorbei, denn dann müssen die Toten ins Jenseits zurückkehren- um im nächsten Jahr wieder von denen, die sie so schmerzlich vermissen, begrüßt werden können.
Halb voll oder halb leer?

Bild: #565984127 von Anna – stock.adobe.com
Im Grunde genommen hat das Jahr doch gerade erst angefangen – zumindest fühlt es sich so an. Aber plötzlich steht schon wieder die Sommersonnenwende am 21. Juni vor der Tür. Für die einen ist es der Moment, den Beginn des kalendarischen Sommers zu feiern, während andere beklagen, dass von nun an die Tage schon wieder kürzer werden. Ob das kalendarische Glas nun dem Sprichwort entsprechend halb voll oder halb leer ist, ist auch eine Frage der Lebenseinstellung und ganz sicher der individuellen Persönlichkeit.
Nicht nur das Jahr bietet Anlass, den Augenblick von zwei Seiten zu betrachten – auch im Leben stehen wir immer wieder vor derartigen Momenten. Für die einen mag es der vierzigste oder fünfzigste Geburtstag sein, für andere die Geburt des ersten Kinds oder Enkelkinds oder der Eintritt in die Rente: Das Gefühl, stolz auf das Erreichte zu sein, geht Hand in Hand mit der Sorge, was die Zukunft bringt. Geburtstag werden entweder beklagt mit den Worten „Ach, nun bin ich schon so alt!“ oder gefeiert mit dem Gedanken „Schön, dass ich das noch erleben darf!“
Ändern lässt sich das Schicksal nun einmal nicht, und es mag psychologisch nur zu verständlich sein, vor dem Lauf der Zeit und dem Gedanken der eigenen Endlichkeit die Augen zu verschließen – wirklich clever ist es selten. Es kostet Selbstüberwindung, darüber nachzudenken, was nach dem eigenen Ende eigentlich sein soll. Gibt es Dinge, die bestimmten Erben hinterlassen werden sollen? Gibt es Wünsche für die eigene Bestattung? Was ist eigentlich mit dem Thema Organspende? Bei der Beantwortung helfen Rechtsanwälte, Notare, soziale Dienste, Hausärzte oder Bestattungsunternehmen mit ihren jeweiligen Kompetenzen gern.
Wer sich den Ruck gibt, um sich diesen Fragen zu stellen, sorgt mit ihrer Beantwortung für etwas mehr Sicherheit. Es ist ein gutes Gefühl, wichtige Entscheidungen für die Zukunft getroffen zu haben – und das Glas des Lebens ist deshalb vielleicht nicht voller, aber dennoch erfrischender. Genießen Sie es!
Ostern ist für alle da

Bild: #103452382 von Axleander Raths - stock.adobe.com
Gekreuzigt – gestorben und begraben – am dritten Tage auferstanden von den Toten: Die Ostergeschichte lässt sich in wenigen Worten zusammenfassen. Die Auferstehung eines Hingerichteten wurde zum Ausgangspunkt der christlichen Weltreligion.
Dem Gedanken der Auferstehung und der Überwindung des Todes kann man sich natürlich theologisch nähern. Allerdings reicht die Fragestellung weit über den christlichen Glauben hinaus: „Was heißt das eigentlich, tot zu sein? Muss das sein – und wenn ja, kann man diesem Schicksal seinen Schrecken nehmen?“ Die Pyramiden der alten Ägypter zeugen von der Beschäftigung mit dieser Frage ebenso wie die Kuppelgräber der archaischen Griechen oder die Überreste früher südamerikanischer Hochkulturen.
Es liegt in der Natur des Menschen, mit seiner Endlichkeit zu hadern, ungeachtet einer kirchlichen Bindung. Und auch das Osterfest ist heute nicht mehr religiösen Familien vorbehalten. Stattdessen feiern wir Ostern als Familienfest, mit einem feinen Essen, der Ostereiersuche für die Kids und dem Wissen, dass nun die Wintertage weitestgehend vorüber sind und der Frühling neu erwacht. Da ist er also wieder, der Gedanken des Neuerwachsens, der nicht nur in der Kirche, sondern ebenso in der Natur verwurzelt ist.
Ein Neuerwachen im Kreislauf von Leben und Tod, von Vergehen und Erblühen oder von Trauer und neuem Mut erleben Familien in der Bewältigung von Verlusten. Es sind nicht die Verstorbenen, die wieder aufstehen – stattdessen sind es die Hinterbliebenen, vor 2.000 Jahren die Jünger ebenso wie heute die Familienmitglieder. Sie verlassen ein Grab, sei es nun am Ostersonntag oder einem anderen Tag des Jahres, halten Zwiesprache, vielleicht stille oder untereinander, und gehen ihren Weg. Das Grab war der Ausgangspunkt der Apostel und ist es für religiöse und kirchenferne Angehörige der Gegenwart gleichermaßen. Es ist eine Stätte, die Trauer in die Erinnerung überführt.
Ostern als Fest für die Lebenden und die Verstorbenen zu feiern, an Omas Grab nach dem Rechten zu sehen und einen fröhlichen Frühlingsstrauß Tulpen oder Narzissen niederzulegen, ist also kein Privileg religiöser Menschen.
Wir wünschen Ihnen frohe Ostern!
Aus Verantwortung für die Familie

Bild: 413766871 Von Photocreo Bednarek https://stock.adobe.com/
Endlich – der Frühling kommt! Wenn das Wetter besser wird und die Sonnenlichtstunden wieder überwiegen, entdecken alle Menschen neuen Enthusiasmus in sich, werden motiviert, Neues auszuprobieren, sprichwörtliche „alte Zöpfe“ abzuschneiden – oder erleben gar die ebenso sprichwörtlichen Frühlingsgefühle. Die wiedergewonnene Energie tut gut und wird regelmäßig auch genutzt, vermeintliche „mühsame“ Aufgaben anzugehen. Der Frühlingsputz der Wohnung gehört häufig dazu, das Auto wird gewaschen und auf Omas Grab werden neue Blumen gepflanzt. Sofern ein Grab existiert.
Denn tatsächlich scheinen Gräber etwas außer Mode zu geraten. Schon seit Jahrzehnten hat sich ein immer höherer Anteil an Feuerbestattungen ergeben, der jüngst durch einen Trend zu pflegefreien Gräbern ergänzt wurde. Mehr und mehr Menschen entscheiden sich für eine Bestattung im Wald, auf See oder in einem anonymen Grab. Eine Forsa-Umfrage im Herbst 2022 ergab, dass nur noch rund 12 Prozent der Deutschen sich eine klassische Erdbestattung im Sarg oder ein Urnengrab auf dem Friedhof (14 Prozent) wünschen. Pflegefreie Grabformen auf Friedhöfen, beispielsweise in einem Kolumbarium, wünschen sich 14 Prozent der Befragten, und eine Waldbestattung ist für 25 Prozent der Befragten attraktiv.
Diese Grabformen erscheinen attraktiv, da sie praktisch sind und eine minimierte Belastung für die Hinterbliebenen versprechen. Viele Menschen wollen ihren Angehörigen die Arbeit und die Kosten der Grabpflege ersparen. Dass diese Arbeit allerdings bei Weitem nicht immer als unangenehm empfunden wird, wird dabei schnell übersehen. Das betrifft nicht nur – aber auch – das alljährliche Ritual der Neubepflanzung im Frühling, die nun wieder anliegt, sondern auch den Strauß Blumen, der am Geburtstag des oder der Verstorbenen am Grab niedergelegt wird, den Besuch beim Sonntagsspaziergang, der Anlass ist, um ein paar Stauden zurechtzustutzen oder einfach nur ein paar Minuten am Grab zu verweilen. Für Hinterbliebene ist dieser Besuch tröstlich, denn Gräber sind Orte des Andenkens – und wer auf ein Grab verzichtet, verwehrt seinen Hinterbliebenen diese Möglichkeit.
Moden vergehen – Stil bleibt

Bild: #112878239 von Moustache Girl – stock.adobe.com
Ein neues Jahr beginnt: In den Medien finden die neueste Mode, die aktuellste Technik und die faszinierendsten Autoneuheiten viel Raum. Was aber ist mit neuen Trends im Bestattungswesen?
Müssten wir nicht auch die elegantesten Sargformen und angesagtesten Urnen, die aufregendsten Grabgestecke oder die Trendfarbe für Grabsteine 2023 diskutieren? Sollte nicht die Trauerfeier schöner und einzigartiger denn je sein und ein modisches Ausrufezeichen setzen, auf das die Nachbarn und Kollegen noch lange voll Bewunderung zurückblicken?
Nein.
Denn es ist möglicherweise die wichtigste Eigenschaft von Trauerfeiern, einen Gegenpol zu modischen Veränderungen zu bilden und stattdessen die Unvergänglichkeit in den Mittelpunkt zu rücken. Mode bedeutet, Vergangenes hinter sich zu lassen, zu vergessen und schnell durch Neues zu ersetzen – Erinnerung hingegen das Gegenteil.
Dieser Erinnerung einen Raum zu lassen und einen Ort zu geben, bedeutet Respekt vor einem verstorbenen Menschen und beweist die Liebe zu ihm. Aber gleichzeitig ist die Erinnerung für die Hinterbliebenen ein wichtiges Element, um mit ihrer Trauer umzugehen.
Es scheint modern, dass Menschen über eine Bestattung ohne sichtbares Grab nachdenken. Sie wünschen sich die Beisetzung auf See, im Wald, als Verstreuung auf einer Schweizer Almwiese oder in einem tschechischen Fluss – oder in einem anonymen Grab auf dem örtlichen Friedhof. Sie wollen ihren Hinterbliebenen nicht zur Last fallen, ihnen die Grabpflege ersparen und keine Kosten aufbürden. Die Überlegungen zeugen von Sorge um die Hinterbliebenen, übersehen aber einen wichtigen Aspekt: Sie nehmen der Familie die Möglichkeit, ihrem Gedenken und der Erinnerung einen Ort zu geben.
Es lohnt sich, der Schnelllebigkeit von Moden zu widerstehen, gerade im Angesicht der Ewigkeit. Die Entscheidung für eine Friedhofsbeisetzung von Sarg oder Urne ist nicht modisch, sondern stilvoll. Stil, der im Jahr 2023 so angesagt ist wie in all den vergangenen Jahren – und es auch in der Zukunft bleiben wird. Ihre Familie wird es Ihnen danken.
Die Qual der Wahl

Bild: #123047656 von Zauberkugel Studio – stock.adobe.com
„Welche Bestattungsart würden Sie für sich in Betracht ziehen?“
So lautet die Frage einer Statista-Erhebung aus 2020*.
Befragt wurden 3.000 Personen aus den Altersklassen „Traditionalisten“ *1935-1949, „Babyboomer“ *1950-1964 und „Generation X“ *1965-1979.
Demnach würden sich 38 % der „Generation X“ heute für eine Waldbestattung und 44 % für eine Urnenbeisetzung auf dem Friedhof entscheiden. Die Generation „Babyboomer“, die vermeintlich näher an der Realisierung der Entscheidung steht, würde sich zu 39% für eine Waldbestattung und zu 41 % für eine Urnenbestattung auf den Friedhof entscheiden. Ähnlich sieht das Gefälle bei den „Traditionalisten“ aus (35 % Waldbestattung, 46 % Urnenbestattung Friedhof).
Erdbestattungen liegen mit 17 % und weniger in allen befragten Gruppen deutlich im Abwärtstrend.
Dieser Trend ist seit Langem beobachtbar und anhaltend – und somit ist absehbar, dass die Waldbestattung die Bestattung auf dem Friedhof überholen wird. Die beiden größten Anbieter sind FriedWald® und RuheForst®. Sie verfügen heute über mehr als 150 Standorte in ganz Deutschland. Hinzu kommen etliche Wald- oder Naturfriedhöfe, die unterschiedliche Betreiber haben, oftmals Waldbesitzer aus der Region. Fast nahezu überall in Deutschland ist ein Bestattungswald erreichbar. Und somit attraktiv.
Aber auch die klassischen Friedhöfe sputen sich, auf den Trendzug „Naturbestattung“ mit aufzuspringen. Freie Flächen für neue Baumanlagen oder andere naturnahe Bestattungskonzepte sind zumindest auf größeren Friedhöfen kein Problem.
Die Gründe für eine Waldbestattung sind vielfältig. Die Nähe zur Natur und das Abwenden vom vermeintlich starren Friedhofskonzept sind zwei Hauptargumente. Auch die nicht notwendige Pflege ist ein Argument, mit dem sich aber auch Friedhöfe schmücken können.
Wer heute in Sachen Bestattung Vorsorge betreibt, kann sich zwischen vielfältigen Konzepten entscheiden. Egal ob „Traditionalisten“, Babyboomer“ oder die „Generation X“ – die Natur ist immer beteiligt.
Informationen findet man im Netz oder beim Bestatter des Vertrauens.
*https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1294781/umfrage/umfrage-zu-favorisierten-bestattungsarten-nach-alter
Netzwerken ist das neue „gemeinsam“

Bild: #164320572 von defpics - stock.adobe.com
Menschen, die Gemeinsamkeiten haben, verbinden sich heutzutage in Netzwerken. Weil es der Stand der (Online-)Dinge ist und weil manchmal der Nachbar oder Freund oder das Kennenlernlokal in der Umgebung fehlt.
Das Onlineportal „Trosthelden“ bringt Menschen zusammen, die trauern und einen Gesprächspartner und Begleiter suchen: einen „Trostpartner“, der in ähnlicher Situation steckt, ähnliche Erfahrungen mit dem Prozess der Trauer macht und eventuell auch jemanden sucht, mit dem er sich austauschen kann.
Im Trauerfall ist es oft so, dass das Verständnis für den individuellen Trauerprozess, der sehr langwierig und schwierig sein kann, fehlt. Beileidsbekundung und Begleitung haben häufig eine geringe Halbwertzeit, denn für die Menschen außerhalb des Trauerprozesses dreht sich die Welt normal weiter. Für den, der trauert, bleibt sie oftmals stehen. Dann kommt zur Trauer auch noch Einsamkeit – keine schöne Kombination für den Betroffenen.
Das Onlineportal „Trosthelden“ bringt Menschen zusammen, die sich in ähnlichen Trauersituationen befinden. Ein ausgefüllter, fein differenzierter Fragebogen wird mittels eines Algorithmus ausgewertet. Sich ähnelnde Profile werden hierbei aufgezeigt und als passende Trostpartner vorgeschlagen. Möchte man diesen kontaktieren, muss man eine Mitgliedschaft abschließen. Die Kosten belaufen sich auf 15 bis 20 Euro im Monat.
Laut „Trosthelden“-Inhaberin Jennifer Lind sind aktuell 2.600 Menschen auf der Onlineplattform aktiv. Die Rückmeldungen sind mehr als positiv. „Trauer braucht ein Gegenüber“, so lautet das Credo der Plattform.
Mehr Information hierzu: www.trosthelden.de
Was ist eine Sterbeamme*?

Bild: #358601694 von lidiia Adobe Stock
Ähnlich wie eine Hebamme bei Müttern und Neugeborenen macht eine Sterbeamme oder ein Sterbegefährte es sich zur Aufgabe, Sterbende und Angehörige im Prozess zu begleiten. Eine Kombination aus praktischem und pflegerischem Wissen im Umgang mit Sterbenden, aber vor allem auch die Intention, mit alltagstauglichen Ideen Mut zu spenden, zu unterstützen und einen Weg durch die Angst zu finden, zeichnet die Sterbeamme/den Sterbegefährten aus.
Die Ausbildung zu dieser intensiven Tätigkeit findet an der „Akademie nach Claudia Cardinal®“ an unterschiedlichen Standorten in Deutschland statt. Claudia Cardinal ist die Initiatorin der Akademie und Heilpraktikerin (BHO).
In der 24-monatigen Ausbildung werden sowohl theoretische als auch praktische Bereiche der Sterbebegleitung intensiv erörtert. Somit wird eine gute Grundlage geschaffen, den sensiblen Prozess des Sterbens und des Trauerns verantwortungsvoll zu begleiten und wertvolle Unterstützung zu leisten.
Für unsere Gesellschaft ist dies sicher eine sinnstiftende Tätigkeit, die den Prozess des Sterbens und den so individuellen Prozess der Trauer in den Fokus rückt. Das hilft denjenigen, die von Sprach- und Hilflosigkeit der heutigen Gesellschaft hinsichtlich dieser Themen betroffen sind.
Mehr Information zu der Intention des Projektes, den Inhalten und Kursabläufen findet man unter:
www.sterbeamme.de
*geschützter Begriff durch Claudia Cardinal
Ein Nachmittag für die Nächstenliebe.

Bild: #60029371 von chaiyon021 - Adobe Stock
Einem Sterbenden die Hand reichen, sie halten, sie vielleicht massieren und mit wohlriechender Creme pflegen – Gesten, die uns nicht leicht fallen, uns manchmal sogar nicht mal möglich sind. Ein natürliches Sterbegeleit ist uns als Gesellschaft abhandengekommen. Zu sehr verdrängen wir den Tod, zu sehr lagern wir ihn aus, zu wenig begleiten wir ihn.
Denn wenn der Aufbruch zur letzten Reise kommt, braucht es Mut, diesen zu begleiten. Noch besser ist es, wenn zu dem Mut richtiges Wissen hinzukommt: Was hilft dem Sterbenden, wie geht man mit nicht bekannten Situationen um, wie kann man selbst stark bleiben?
Der „Letzte Hilfe Kurs“ der Letzte Hilfe Deutschland gemeinnützige GmbH bietet grundlegendes Wissen zu diesem Thema an, quasi das kleine Einmaleins der Sterbebegleitung. In mehrstündigen Kursen werden die Themenfelder „Sterben als Teil des Lebens“, „Vorsorge und Entscheidungen“, „Leiden lindern“ und „Abschied nehmen“ behandelt. Es sind keine wissenschaftliche Abhandlungen, sondern verständliche Informationen und vor allem anwendbare Hilfen, die die Kursteilnehmer:innen ermutigen, einem nahestehenden Sterbenden die Hand zu reichen und ihn zu begleiten. Als Akt der Nächstenliebe und der Fürsorge für den Sterbenden – aber auch für sich selbst.
Auch für Kinder und Jugendliche gibt es altersgerechte Kurse, zumeist in Kooperation mit den Schulen oder Gemeinden.
„Wir möchten Grundwissen an die Hand geben und ermutigen, sich Sterbenden zuzuwenden. Denn Zuwendung ist das, was wir alle am Ende des Lebens am meisten brauchen.“ So zu lesen auf der Website der Gesellschaft.
So ist also der „Letzte Hilfe Kurs“ auch für uns als soziale Gesellschaft ein Ansporn für mehr Engagement und für ein Miteinander bis zuletzt.
Mehr Information zur Letzte Hilfe Deutschland gemeinnützige GmbH, zu den Kursen und Kursterminen unter: www.letztehilfe.info
Der Tod kostet…!
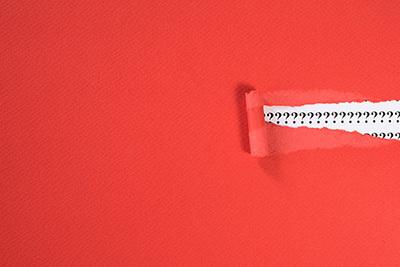
Bild: #288598202 von Hafiez Razali - stock.adobe.com
Preissteigerung – wohin man schaut …
Der Tod ist auch heute in der Regel noch vor allem eines: diskret. Man spricht nicht so gern über das Thema Sterben, genauso wenig wie über Geld.
Im Zuge der vergangenen Pandemie und nun auch des nahen Krieges ist aber das Thema Tod und auch das Thema Inflation allgegenwärtig. Kein Tag ohne Todesfälle, kein Tag ohne Berichte über Lieferkettenschwierigkeiten und Preiserhöhungen.
Nicht nur bei konkreten Trauerprodukten wie den Särgen wird die Preissteigerung für den Endkunden spürbar sein. Die Kosten für das Rohmaterial Holz sind genauso gestiegen wie die Kosten für Nägel und Metallgriffe, bei manchen Sargherstellern gibt es Preissteigerungen von bis zu 25 Prozent.
Und nicht nur das: Das Thema Energiewende wird sich ebenso auswirken. Gestiegene Spritpreise führen zu höheren Überführungskosten, gestiegene Gaspreise zur Erhöhung der Gebühren im Krematorium. Eigentlich eine auf der Hand liegende, wenn auch ärgerliche Entwicklung.
Aber die stille Branche hat ein Kommunikationsproblem: Über den Tod und die Kosten, die hierbei entstehen spricht man eben nicht gern öffentlich. Die Dienstleistung des Bestatters ist in der öffentlichen Wahrnehmung unkonkret, unvorstellbar und deshalb in vielen Augen auch unseriös. Diese – sagen wir – „Informations-Vorenthaltung“ wird jetzt umso mehr einen unangenehmen Effekt mit sich bringen. Denn die Preise werden auch weiterhin steigen und auf den Endkunden umgelegt werden.
Stille Kommunikation ist also auch in Zukunft nicht gut, denn dann entsteht ein „Stille-Post-Effekt“. Sprechen Sie den Bestatter Ihrer Wahl doch einfach mal an. Fragen kostet: nix!
Der Frühling ist da …

Bild: #292755182 – von Nataba – stock.adobe.com
Die Natur erwacht, die Tage werden länger, dem Glückshormon Serotonin wird durch Sonnenstrahlen ordentlich eingeheizt. Also nichts wie raus, den Winterblues abschütteln und durchstarten.
Besonders wenn man in der dunklen Jahreszeit einen Angehörigen verloren hat, ist jetzt eine gute Zeit, wieder Hoffnung zu spüren und dem Verlust und der Trauer etwas entgegenzusetzen: Lebensfreude! Der Gang auf den Friedhof hilft hierbei im Frühling und Sommer ungemein, denn alles ist auf „positiv“ gestellt.
Im Wonnemonat Mai blüht es überall, die Vögel zwitschern lebensfroh und die Menschen sind wieder unterwegs. Begegnungen sind wieder möglich – gerade auf dem Friedhof! Hier kann jeder einfach nur die grüne Oase genießen. Oder noch besser: selbst Hand anlegen und das Grab des Verstorbenen für die nächsten Monate zur blühenden Landschaft machen. Trauerarbeit von ihrer besten Seite!
Ewas gewagt könnte man auch sagen: „Der Frühling ist der Sieg des Lebens über den Tod.“
Probieren Sie es doch mal aus!
Mehr Normalität beim Abschied!

Bild: Rawpixel.com /stock.adobe.com
Am 19. März sind sie ausgelaufen, die strengen Coronaschutzregeln, die in den letzten beiden Jahren auch den Kern der Bestattung eines jeden getroffen hat – die würdevolle Verabschiedung der Verstorbenen.
Kein persönlicher und privater Abschied, keine Trauerfeier mit Angehörigen und Freunden, begrenzte Teilnehmerzahlen sogar auf den Außenflächen der Friedhöfe – trauriger Alltag der letzten beiden Jahre. Und maßgeblich für die Trauerarbeit der Hinterbliebenen. Vieles ist auf der Strecke geblieben, vieles in belastender Erinnerung.
Mit dem geänderten und beschlossenen Infektionsschutzgesetz ist die Aussicht auf würdevolle und wohltuende Abschiede wieder greifbar nah. In Trauerhallen und auf dem Friedhof. Mit genau den Personen, die sich verabschieden möchten, ohne Begrenzung, ohne G-Vorschrift*.
Das wird unserer Bestattungskultur gut tun, denn der Trend zur schnellen und anonymen „Entsorgung“ darf nicht durch Beschränkung verstärkt, Angehörige dürfen nicht sich selbst überlassen werden.
Abschiede dürfen und sollen wieder begangen werden, aus Respekt für die Verstorbenen und für die Zukunft der Hinterbliebenen. Zumindest bis auf Weiteres …
* Natürlich können die Länder bei einer Gefahrenlage die Maßnahmen wieder verschärfen, und in den Innenräumen besteht bei nicht einzuhaltendem Abstand Maskenpflicht – aber entspricht dies nicht auch dem gesunden Menschverstand?
Friedhof – ist doch was für die Lebenden!

Bild: #31204579 von Miguel Cabezon – adobe.com
Unterwegs auf dem Friedhof – tagsüber oder in der Dämmerung: ein sicher spannendes Event, welches sich die „Schwarze Witwe“ alias Anja Kretschmer ausgedacht hat. „Friedhofsgeflüster“ heißt das Programm der engagierten Kunsthistorikerin mit dem Faible für den Gottesacker.
Die Führungen handeln von alten Zeiten, Sitten und Bräuchen, Aberglauben und der Totenkultur. Erzählt werden Geschichten und Sagen aus dem deutschsprachigen Raum. Diese sind, laut Anja Kretschmer, gelebte Geschichten unserer Ahnen. Die Bestattungskultur des 16. bis 19. Jahrhunderts steht im Vordergrund der Erzählungen: der Umgang mit dem Tod und der eigenen Sterblichkeit im geschichtlichen Kontext. Eine spannende Sache!
Seit Jahren schon tourt die Kunsthistorikerin mit ihrem Programm durch ganz Deutschland. Endlich nun wieder mit vielen Terminen für 2022, im März zum Beispiel in Halberstadt und im April in Rostock (Information laut Website, siehe unten).
Es gibt unterschiedliche Themenführungen – wie Friedhofsgeflüster I „Tod und Begräbnis früher: Von Leichenbitter, Wiedergängen und Totenkronen“ oder Friedhofsgeflüster II „Kultur des Abschieds und der Trauer: Von Totenwache, Post-Mortem-Fotografie und der Angst vor dem Scheintod“.
Zum gesamten Programm und den Hintergründen und vor allem zu den Terminen kann man sich auf der Website der „Schwarzen Witwe“ schlaumachen: www.friedhofsgefluester.de
Tod, Bestattung, Beisetzung, Friedhof?

Bild: #290930820 von Anze - stock.adobe.com
Die Paragrafen des BestG (Bestattungsgesetzes) regeln – föderal – alles in Sachen Bestattung in Deutschland. So gilt laut Gesetz, nach dem Tod den Leichnam zu bestatten und beizusetzen. Entweder im Sarg oder in einer Urne.
Um einen Scheintod auszuschließen, gibt es in den meisten Bundesländern eine Bestattungsmindestfrist von 48 Stunden. Das heißt, erst dann darf die Erdbestattung oder eine Einäscherung stattfinden. Die Bestimmungen sind jedoch je nach Bundesland unterschiedlich. Auch die Maximalfrist variiert von 4 Tagen über 5, 6, 7 oder 8 Tage bis hin zu 10 Tagen in NRW, der Pfalz oder in Thüringen.
In Sachen Sarg meint der Gesetzgeber mit Bestatten auch gleichzeitig Beisetzen, also ist die Bestattungsfrist hierfür auch gleichzeitig die Beisetzungsfrist. Das macht Sinn, denn ein Körper, der nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird, verwest. Er muss aus gesundheitshygienischen Gründen innerhalb bestimmter Fristen beigesetzt werden.
Eine Urne aber, deren Inhalt ja bereits bestattet und keinerlei Veränderungsprozessen mehr ausgesetzt ist, muss trotzdem beigesetzt werden. Aber die Beisetzungsfrist währt meistens bis zu 6 Wochen – in Bayern beispielsweise sogar 3 Monate. In fast allen Bundesländern herrscht nach wie vor Friedhofspflicht, auch für die Beisetzung von Urnen.
Neben hygienischen Aspekten geht es auch um die Würde des Toten und sein Recht auf die Totenruhe. Diese soll hierzulande auf einem Friedhof gewährleistet werden. Der Tote soll nach der Beisetzung einen beständigen, würdevollen und angemessenen letzten Ort haben. Der heißt aber immer Friedhof.
Nur nicht in Bremen: Hier können die Angehörigen die Urne mit der Asche des Verstorbenen (auf Antrag) mit nach Hause nehmen und im Garten verstreuen – und zwar nur im eigenen Garten.
Sprich: Also auch im Garten kann die Totenruhe eingehalten und die Würde bewahrt werden. Was ist in Sachen Würde in Bremen anders als zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen? Wie sieht es mit den trauernden Bremern aus, die nur einen Schrebergarten gemietet haben: Dürfen die das auch? Oder warum ist ein Balkon kein geeigneter Aufenthaltsort für eine Urne – die Asche befindet sich ja in einer versiegelten Kapsel in der Urne?
Diese und viele andere Fragen stellen sich, wenn man sich mit dem an die 200 Jahre alten Bestattungsgesetz beschäftigt. Was ist zeitgemäß, was nicht? Wer bestimmt, was Würde ist und was nicht?
Ein Thema, das uns alle angeht. Nur darüber sprechen – das tun wir nicht so gern.
Dezember – jetzt wird’s ernst.

Bild: #344142327 von deagreez – stock.adobe.com
Dezember – jetzt wird’s ernst.
Zumindest für alle, die in diesem Jahr einen lieben Angehörigen verloren haben. Denn oftmals ist die Weihnachtszeit der Gradmesser für unser (aller) Seelenheil.
Wie das erste Familienfest ohne den Verstorbenen feiern? Wie die stillen Tage überstehen, an denen sich die Familien mehr oder weniger fröhlich, aber immer eifrig treffen?
Ein Patentrezept gibt es natürlich nicht, aber vielleicht die ein oder andere Anregung. So könnte es gut sein, den Verlust bewusst zu thematisieren. Sprechen Sie mit Ihren Freunden oder Angehörigen darüber, wie es letztes Jahr war: liebevoll, lustig, langweilig, wie immer, anstrengend, schön, kaum auszuhalten oder oder. Das Motto ist: „Weißt du noch?“ Jeder, der mag, kann eine Erinnerungsgeschichte mitbringen: So wird die Erinnerung lebendig und das Miteinander im Hier und Jetzt bewusst.
Das Aufsuchen von gemeinsam besuchten Orten geht auch ganz allein, vielleicht so sogar am besten. Die letzte gemeinsame Wanderung noch einmal machen, in das zuletzt besuchte Museum gehen oder mit dem gemeinsamen Lieblingsgetränk und viel Zeit das Grab besuchen, Klappstuhl inklusive. Das ist gut allein möglich, denn dann kann man in Erinnerung schwelgen und Zwiesprache halten, ganz für sich.
Vielleicht gibt es auch in Ihrer Nähe Menschen, die mit Verlusten fertig werden müssen. Eine kleine Aufmerksamkeit, die vielleicht Trost bringt, ist eine schöne Geste von Mensch zu Mensch. Immer – aber besonders in der Weihnachtszeit.
In diesem Sinne – eine schöne Weihnachtszeit!
Der Friedhof – hier tobt das Leben!

Bild: #335239530 von Johnny - stock.adobe.com
Gedanken zum Buch „Gestatten Sie, dass ich liegen bleibe: Ungewöhnliche Grabsteine – Eine Reise über die Friedhöfe von heute“
Friedhofssoziologie ist ein interessantes Wissens- und Forschungsgebiet, so meinen zumindest die Soziologen Thorsten Benkel und Matthias Meitzler der Uni Passau, die seit 2011 empirische Sozialforschung in verschiedenen „Todeskontexten“ betreiben und innerhalb dieser auf 500 deutschen Friedhöfen Feldforschung mit unterschiedlichen Schwerpunkten durchführen. Es gibt sogar eine eigene Website: www.friedhofssoziologie.de
Mehrere Bücher haben die beiden Soziologen bislang zu dem Thema veröffentlicht, eines trägt den Titel „Gestatten Sie, dass ich liegen bleibe“. Es beschäftigt sich mit der Kultur und der Veränderung der Grabgestaltung. Der individualisierte Friedhof. Aus 30.000 Fotos haben die Autoren die eindrucksvollsten Bilder ausgewählt: Sie geben einen Einblick über das letzte Namenschild, die letzte Adresse, den letzten Kult.
Der Spiegel kommentierte dazu: „Der Friedhof von heute hat etwas von Facebook; der Grabstein als letztes Profil, für Jahrzehnte in Stein gemeißelt.“
Von skurrilen und ungewöhnlichen letzten Worten wie: „Guck nicht so doof, ich läge jetzt auch lieber am Strand“ bis hin zu: „Geht nicht gibt’s nicht“ ist so allerlei vertreten. Ernstes, Humorvolles, Zitiertes, Charakteristisches – eben etwas Individuelles auf Augenhöhe zwischen Verstorbenem und Besucher.
Ob im Buch oder vor Ort: Der Friedhof ist ein Ort für Entdecker. Statten Sie ihm einen Besuch ab!
Thorsten Benkel und Matthias Meitzler
Gestatten Sie, dass ich liegen bleibe
Ungewöhnliche Grabsteine – Eine Reise über die Friedhöfe von heute.
ISBN 9783462046083
Leben bis zum Schluss – Welthospiztag

Bild: #165602663 von Nikki Zalewski – stock.adobe.com
Im Hospiz verbringen unheilbar kranke Menschen ohne Aussicht auf Heilung ihre letzten Stunden, Tage oder Wochen. Wenn sie denn dort einen Platz bekommen.
Ein paar Zahlen und Fakten*
In Deutschland gibt es 250 stationäre Hospize für Erwachsene und 18 stationäre Hospize für Kinder und Jugendliche. Die Erwachsenen-Hospize haben im Durchschnitt je circa 10 Betten, das heißt: Es gibt circa 2500 Hospizbetten, in denen bei einer durchschnittlichen Auslastung von 80 Prozent und einer Verweildauer von 22 Tagen pro Jahr circa 33.500 Menschen versorgt werden.
Hört sich erst einmal viel an, ist es aber nicht. Nicht jede Stadt oder Gemeinde verfügt über ein Hospiz. Durch den meist akuten Bedarf gibt es Engpässe, ein frei werdender Platz kommt oftmals zu spät.
Der von den Kranken- und Pflegekassen anerkannte und real kalkulierte Tagessatz für einen Hospizplatz liegt bei circa 450 Euro. Hierin enthalten sind die Leistungen des Hospizes wie Pflege, Betreuung, Unterkunft und Verpflegung. 95 % der Kosten werden übernommen, 5 % der Kosten müssen von den Hospizen selbst aufgebracht werden. Legt ein Hospiz besonderen Wert auf eine intensivere und qualitativ hochwertigere Betreuung durch einen hohen Personalschlüssel – und das ist die Regel –, müssen die Zusatzkosten vom Hospiz selbst getragen werden. So kommen schnell wesentlich höhere Eigenkosten auf die Hospize zu.
Die Eigenkosten werden aus Spenden und aus ehrenamtlicher Tätigkeit bestritten. Jede Mitgliedschaft, jede Spende hilft, mehr Plätze zu schaffen und mehr Menschen – Erwachsenen wie auch Kindern – die Möglichkeit zu geben, bis zum Schluss zu LEBEN.
Mit den jährlich stattfindenden Hospiztagen, Welthospiztag am 9. Oktober und der Deutsche Hospiztag am 14. Oktober 2021, wird das wichtige Thema erneut in der Öffentlichkeit fokussiert.
Menschen ansprechen und informieren!
Interesse, Engagement und Spenden generieren!
Mehr Wissenswertes dazu unter: www.dhpv.de
*Quelle: Deutscher Hospiz und Palliativverband, www.dhpv.de/zahlen_daten_fakten.html
Erinnerungen

Bild: Adobe Nr. 185888765 von ThomBal
Every cloud has a silver lining
So sagt ein englisches Sprichwort und meint: „In allem Schlechten steckt auch etwas Gutes.“ Oder: „Auf jeden Regen folgt Sonnenschein.“ Oder: „Ein Silberstreif am Horizont.“
Sicher ist das im Trauerfall nur ein schwacher Trost, wenn nicht sogar unpassend und makaber. Dennoch hilft es vielleicht, den Tod einer nahestehenden Person zu begreifen, wenn man sich dem Tatsächlichen und dem Zukünftigen nähert – wenn man sich dem Leben zuwendet.
Die positiven Aspekte zusammentragen und gegen den Verlust aufstellen – eine simple Rechnung machen! Das könnte ein Rezept sein, für sich Trost im Verlust zu finden. Alle Erinnerungen in die positive Waagschale legen, den Verlust in die andere. Vielleicht gelingt es so, die Waage „Trauerfall“ zugunsten der positiven Waagschale zu beeinflussen. Mit jeder positiven Erinnerung ein wenig mehr!
Was waren die schönsten, emotionalsten, skurrilsten Momente mit dem Verstorbenen? Was ist aus der Verbindung entstanden, was hätte man nicht erlebt ohne diesen Menschen? Was kann man in Erinnerung an diesen Menschen ganz bewusst tun? Zum Beispiel eine Reise antreten, von der man immer gesprochen hat. Ein Bild erstehen, das dem Verstorbenen so gut gefallen hat. Ewas tun, wozu uns der andere immer ermutigt hat!
Wenn die positive Waagschale dann langsam wieder an Gewicht und Bedeutung gewinnt, dann sieht man ihn: den Silberstreif am Horizont.
Sommerloch

Bild: #356687931 von kichigin19 - stock.adobe.com
Bananen, Pilze, Bambus und andere Bioprodukte eignen sich wohl oder durchaus oder natürlich oder in Zukunft als Rohmaterial für Särge – und zwar für biologisch einwandfreie Särge.
So baut die niederländische Firma Loop Särge aus Pilzgeflecht. Wer sich in so einem „Lebenden Kokon“ begraben lässt, macht quasi der Erde noch zuletzt ein Geschenk: so zumindest der Hersteller. Der Sarg soll sich innerhalb eines Monats vollständig auflösen und das Myzel, der Pilz, als Recycler des Waldes eine gute ökologische Bilanz hinterlassen – und noch besser: sogar den Wald reinigen. Auch der im Inneren des Kokons liegende Körper soll (!) sich schneller zersetzen bzw. kompostieren. Was genau „schneller“ heißt, bleibt eher undefiniert. „Unser lebender Kokon ermöglicht es den Menschen, wieder eins mit der Natur zu werden und den Boden anzureichern, anstatt ihn zu verschmutzen", sagt Bob Hendrikx, der Firmengründer.
Geeignet sind diese Särge laut Hersteller vor allem für eine Waldbestattung – in den Niederlanden ohne Friedhofspflicht offenbar kein Problem. Eine Waldbestattung hierzulande gibt es nur in ausgewiesenen Ruhewäldern und nach einer Feuerbestattung.
Eine Alternative zu einem „Pilzbegräbnis“ könnte eine Bestattung in einem Sarg aus wilder Ananas (Pandanus) und Bambus sein. So stellt die in Deutschland sitzende Firma boscamp greencoffins Särge aus Naturmaterialien her, die sich schon rein optisch von den klassischen Holzsärgen absetzen. Sie erinnern eher an Weidenkörbchen in XXXL. Alle Produkte tragen laut Hersteller das Eco-Fairtrade- oder das FSC-Zertifikat.
In Sachen Sarg tut sich was! Ob nachhaltig oder nur als Idee – das wird sich zeigen.
Mehr Information zu den Herstellern und Produkten:
www.greengadgets.de und www.boskampgreencoffins.de
Online

Bild: #289092306 von agenturfotografin – stock.adobe.com
Digitale Welten beim Bestatter: Pflicht oder Kür – Gegenwart oder Zukunft?
Onlinebestattungen, Gedenkportale, digitale Beratungen. Das sind recht neue Vokabeln in der Bestatterbranche. Den ein oder anderen Onlinedienst gab es schon vor der Pandemie, aber eine wirkliche Auseinandersetzung mit der digitalen Welt oftmals nicht. So sind Bestattungsangelegenheiten tatsächlich eine Sache „face to face“.
Die Pandemie aber hat, wie in vielen anderen Bereichen, Grenzen aufgezeigt: Was geht eigentlich, wenn nichts mehr geht? Gefragt sind kontaktlose Kontakte: zum Impfzentrum, zum Arzt, zur Boutique und zum Restaurant. „Online“ und „to go“ heißen die Zauberwörter.
Eine Bestattung „to go“? Sicher nicht, aber eine umfangreiche und adäquate Beratung „online“ ist denkbar und möglich. So haben einige Bestatter ihre Technik längst aufgerüstet, um seriöse und gute Onlineberatungen mit Bild und Ton inklusive Produktauswahl und Vertragsabschluss zu ermöglichen. Ein Link via E-Mail zum Kunden – und ein Computer mit Kamera, ein Laptop, Tablet oder sogar ein Smartphone auf der Kundenseite reichen aus.
„Face to face“ geht so auch ohne Kontakt. Eine gute Onlineberatung überwindet Grenzen und Entfernungen. Denn sie ist nicht nur in Ausnahmezeiten, sondern auch im heutigen Onlinealltag eine Alternative.
Besuchen Sie die Website Ihres Bestatters und fragen Sie ihn nach seinen Möglichkeiten!
Makaber oder innovativ?

Bild: #307563464 von alswart – stock.adobe.com
Nowosibirsk Mai 2021: Bestatter messen sich im Gräberschaufeln
In der Woche ab dem 15. Mai 2021 konnte man in allerlei Print- und Onlinemedien Ungewöhnliches lesen: Bestatter aus der Region Nowosibirsk hatten sich einen Wettkampf geliefert: In möglichst schneller Zeit musste ein zwei Meter langes Einzelgrab ausgehoben werden. Angeblich beteiligten sich 8 Teams bei dem Wettbewerb. Das schnellste Team kam aus Omsk und gewann, laut Medienberichten, nach 38 Minuten und kassierte umgerechnet an die 350,00 Euro. Die genaue Ausführung des Aushubs wurde nicht mit einem Maßband, sondern direkt mit einem Sarg kontrolliert.
Bei dem Wettbewerb sollte es sich laut Veranstalter, der namentlich leider nicht bekannt ist, nicht um ein makabres Spaß-Event handeln. Im Gegenteil – das Anliegen soll durchaus ernsthaft gewesen sein: Der Beruf des Bestatters sollte für jüngere Menschen attraktiv kommuniziert werden. Auch in Russland hat die Bestatterbranche Nachwuchsprobleme.
Ob man in Russland über eine solche Aktion Interesse am Berufsstand Bestatter wecken kann, sei dahingestellt. Die russische Seele und Mentalität gelten gemeinhin durchaus als düster, schwermütig und in jedem Fall emotional. Aber auch als unsensibel, grob und makaber? Das darf bezweifelt werden. In einem Kommentar in den sozialen Netzwerken soll es geheißen haben: „Wir warten nun auf Wettbewerbe wie die schnellste Autopsie und die schnellste Einäscherung.“
Eben: andere Länder, andere Sitten.
Selbstfürsorge

Bild: #424104746 von scott – Adobe Stock
Wie einem der Schnabel gewachsen ist: Poesie – ein Weg in die Zukunft.
Der Tod eines sehr nahestehenden Menschen ist immer eine Krise. Selbst wenn der Tod nach langer, unheilbarer Krankheit eine Erlösung zu sein scheint. In Zukunft liegt vor den Hinterbliebenen ein Leben ohne den Partner, ohne den Freund, ohne das Kind …
Ein Schicksalsschlag, der das Leben ändert – ob man will oder nicht. Und in jedem Fall geht das Leben weiter. Die Zeit bleibt nicht stehen.
Eine Auseinandersetzung mit dem Erlebten und mit der Krise hilft, in der Zeit zu bleiben und Schritte in Richtung Zukunft zu gehen. Nicht immer steht hierfür ein menschlicher Begleiter zur Verfügung. Aber auch ohne kann man ins Gespräch kommen – mit sich selbst! Das Vehikel dazu: Papier. Etwas in eigene Worte fassen und niederschreiben entlastet und bietet einen Weg, eine Situation – eine Krise – zu ordnen.
Das hat diverse Vorteile: Im Selbstgespräch kann man reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Kein Gefühlsausbruch ist unangenehm, kein Gestammel peinlich, es gibt kein Tabu, das nicht gebrochen werden kann. Als treuer und vertraulicher Partner ist das Papier ein Helfer, ein Begleiter und gefüllt ein Archiv der eigenen Gefühlswelt. Eine ganz eigene Poesie!
Innerhalb der psychotherapeutischen Kreativtherapie ist Schreiben – wie auch Malen oder Tanzen – eine alternative Methode der Selbstheilung. Dies kann man ganz für sich probieren – oder begleitet mit externer Hilfe eines Poesietherapeuten. Auch in der Literatur findet man viele interessante Anregungen und Hilfestellungen. Psychotherapeuten und Literaten sind sich einig: „Schreiben kann helfen, Stimmungen auszuhalten und Krisen zu bewältigen.“
Also vielleicht einfach loslegen und sich beschäftigen – mit sich selbst und der aktuellen Situation. Eine eigene Poesie kreieren und so ganz unverblümt für sich selbst sorgen.
„40 Tage fasten, 50 Tage feiern – die Osterzeit“

Ein kleines 1x1 der christlichen Bräuche.
Wir erinnern uns: Aschermittwoch – in diesem Jahr für alle Karnevalsliebenden besonders bitter: keine vorausgehende 5. Jahreszeit, keine Sitzungen mit all den herrlichen Persiflagen und satirischen Reden, kein Schunkeln, kein Rosenmontagszug.
Aber trotz allem ist Aschermittwoch auch im Jahr 2021 der Beginn der Fastenzeit, auch Passionszeit genannt: 40 Tage ohne.
Am Gründonnerstag ist es dann geschafft. 40 Tage Fastenzeit mit Verzicht, Buße und Besinnung sind durchgestanden. In Demut beginnt an diesem Tag das Osterfest. Gründonnerstag hat in der Liturgie eine große Bedeutung. Ein besonderer Blick richtet sich im Gottesdienst auf das letzte Abendmahl Jesu, der am Vorabend seines Todes seinen Jüngern nach der Überlieferung die Füße wusch. Eine Demutsgeste.
Karfreitag ist der Tag der Kreuzigung, ein Feiertag, der auch in diesem Sinne begangen wird: kein Blumenschmuck in den Kirchen, ein leerer Altar, ein Gottesdienst mit eigenen Regeln. Der Wortbestandteil „Kar“ bedeutet Klage, Kummer oder Trauer.
Auf den Todestag Jesu folgt ein Tag der absoluten Stille. Am Karsamstag ist Grabesruhe, es finden keine Gottesdienste statt. Es ist still.
Ostersonntag ist der Tag der Auferstehung Jesu Christi. Es ist der ranghöchste Festtag im Kirchenjahr. Bereits in der Osternacht zuvor, erwarten die Gläubigen in einer Nachtwache (Gottesdienst) die Auferstehung Jesu. Die Messen beginnen am Karsamstag nach Sonnenuntergang und enden vor Sonnenaufgang am Ostersonntag. Der Ostersonntag ist immer der 1. Sonntag nach dem 1. Vollmond nach Frühlingsanfang. Ostern wird also frühestens am 22. März und spätestens am 25. April gefeiert. Nach dieser Rechnung richtet sich die Karnevalszeit mit Rosenmontag und Aschermittwoch: 40 Tage ohne.
Der 50. Tag der Osterzeit und auch ihr Ende ist Pfingsten. An Pfingsten sandte der auferstandene Jesus Christus, an der Seite seines Vaters, seinen Jüngern den Heiligen
Sternenkinder

Bild: #108348174 von Stefanie Garau – stock.adobe.com
Nicht den Tod, sondern das Leben in Erinnerung bewahren.
Das könnte ein schöner Leitsatz für einen jeden Todesfall sein und es wäre für die, die weiter am Leben teilhaben, eine wunderbare Sache, wenn sie gelänge − oder besser, wenn sie gelingt.
Wenn kleinste Kinder, im Mutterleib oder nach der Geburt, sterben, ist das eine schier unerträgliche Situation. Unbeschreiblich, kaum nachfühlbar und einer Ohnmacht nahe. Wie soll es hier gelingen, das Leben, das noch gar nicht oder kaum stattgefunden hat, in Erinnerung zu bewahren?
Die Initiative DEIN STERNENKIND STIFTUNG schenkt betroffenen Eltern eine Erinnerung, die die Existenz des kleinen Lebens dokumentiert und die vielleicht die einzig sichtbare Erinnerung für die Familien ist. Über 600 ehrenamtlich tätige Fotografinnen und Fotografen fotografieren diese Sternenkinder und machen sie so sichtbar − in 2020 in mehr als 3.200 Fällen im deutschsprachigen Raum. Im Jahr 2017 war die Stiftung bereits Preisträger des Deutschen Engagementpreises (Publikumspreis).
Die Erinnerungsfotos sind eine greifbare Stütze für die Zeit der Trauer und die Zeit der liebevollen Erinnerung. Für die Eltern, die Geschwister und für alle, in deren Leben das verstorbene Kind einen Platz hat.
An die Stiftung kann man sich als Betroffener selbst, aber auch als Hebamme, als Geburtsstation eines Krankenhauses oder natürlich auch als Bestatter wenden. Das Netzwerk der Stiftung ist weit gespannt, so dass auch in der Kürze der Zeit reagiert werden kann.
Mehr Information zu der Stiftung unter www.dein-sternenkind.eu
Neues in Sachen: der letzte Gang

Bild:#184692821 von grebnerfotografie - stock.adobe.com
Klimaneutral zur letzten Adresse
Die Bestattungsbranche ist bekanntermaßen eher zurückhaltend, weniger innovativ oder gar extrovertiert veranlagt. Das kommt aus der Sache an sich: So sind doch das Sterben, der Tod und alles, was damit zusammenhängt, immer noch nicht aus ihrer Tabu-Ecke herauszubekommen. Der Tod ist nach Möglichkeit nicht sichtbar – und das ist ja irgendwie auch verständlich.
Trotzdem ist hier und da in der Bestattungskultur etwas los, sei es bei ungewöhnlich inszenierten Abschiedsfeiern mit Rockmusik und einem Hellem am Grab oder mit einer Lichtershow in der Trauerhalle. Das Grabmal kann ein Klassiker aus Stein sein, aber auch eine Skulptur aus rostigem Cortenstahl. Auf dem Grabmal steht: „In Liebe“, aber durchaus auch: „Tiefergelegt am …“.
Auf den Friedhof kommt der Verstorbene oftmals mit einer leistungsstarken Luxuskarosse mit Sternenhimmel und Seidenvolants, oder - und das ist doch mal eine Nachricht wert: mit dem Fahrrad.
Seit dem Herbst 2020 gibt es in Oldenburg ein Bestattungsfahrrad. Ein Unikat und eine Sonderanfertigung des Oldenburger Künstlers Michael Olsen. Seine Idee: den Tod und Abschied wieder sichtbar machen. Dort, wo alltäglich das Leben pulsiert: auf der Straße. Mit dieser Idee und der ersten Testfahrt hat er positive Resonanzen und auch eine Bestatterin, die dies mit in ihr Programm aufnehmen möchte, gefunden. „Reduziert, wertschätzend und angemessen langsam.“ So beschreibt eine Passantin begeistert ihren Eindruck.
Für eine Fahrradstadt wie Oldenburg scheint das eine fast naheliegende Idee zu sein, zumindest eine, die sich damit beschäftigt, den Tod doch noch aus seiner Tabu-Ecke herauszuholen. Und klimaneutral ist sie zudem, die letzte Fahrt auf zwei Rädern.
GOTT - von Ferdinand von Schirach

Bild: #323740019 von Bernulius - stock.adobe.com
Wieder einmal ein Fernsehbeitrag, der sich mit dem Sterben beschäftigt. Besser: mit der Frage nach der Hilfe zum Sterben, explizit mit der Hilfe zum Suizid. Und vor allem: mit der Einstellung der Gesellschaft dazu – mit der Moral unserer Zeit.
Das Buch GOTT von Ferdinand Schirach ist noch recht frisch, erst im September dieses Jahres kam die Erstausgabe in die Bücherläden. Parallel dazu wurde die Bühnenversion an einigen Theaterhäusern ins Programm genommen und ein ARD-Fernsehkammerspiel gedreht.
Es geht um die Frage: „Darf ein Mensch selbstbestimmt sterben und sich hierbei professionelle Hilfe suchen?“ Grundsätzlich hat das Bundesverfassungsgericht dieses Jahr im Februar in Sachen Sterbehilfe ein Urteil getroffen, das „ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben“ vorsieht – sowie das Recht, hierfür Hilfe bei Dritten zu suchen.
Bei dem Stück GOTT geht es um die Frage, welche gesellschaftliche Instanz mit welcher Moral eine solche Fragestellung wie beantworten würde. Was ist unsere Moral, wer beschreibt sie – und steht sie im Gegensatz zu unserer Lebenswirklichkeit und vor allem im Gegensatz zu unseren Gesetzen?
Ferdinand von Schirach nimmt in seinem Buch und vor allem auch im Theater und im Film uns als Zuschauer unmittelbar mit ins Boot, er macht uns zu Mitdenkern und Mitentscheidern. Er will, dass wir uns mit Fragen auseinandersetzen, die sich uns sonst so wahrscheinlich nicht stellen, da sie Ausnahmeerscheinungen und nicht alltäglich sind.
Der (Deutsche) Ethikrat, der hierbei ebenso angerufen wird, beschäftigt sich auch im wirklichem Leben mit den Fragen der Gesellschaft und des Lebens. Er gibt Stellungsnahmen zu Themen unserer Zeit heraus und ist für die Politik und auch für die Öffentlichkeit Berater und Impulsgeber.
Sehenswert also der Film GOTT von Ferdinand von Schirach, in der ARD-Mediathek noch bis zum 23.12.2020.
Informativ: Deutscher Ethikrat www.ethikrat.org
Das große Gruseln: hier und anderswo

Bild:#285303360 von duncanandison - stock.adobe.com<
Trotz Corona wird es das wohl geben: Hexen, Zombies und Vampire auf den Straßen.
„Süßes oder Saures“ dürfen die Kinder – hoffentlich mit viel Spaß und Abstand – an den Türen der Nachbarn rufen und sich über allerlei süße Gaben freuen.
Der evangelische Reformationstag (31. Oktober), das katholische Allerheiligen und Allerseelen (01./02. November) stehen vor der Tür und somit auch für alle Nichtgläubigen oder einfach feierlustigen Menschen Halloween. Gefeiert wird das ursprünglich heidnische und aus Irland kommende Fest am 31. Oktober. Wenn auf den katholischen Friedhöfen die Seelenlichter leuchten, gehen sie auf die Straße, die gruseligen Geschöpfe aller Couleur.
Schafft man es hierzulande nicht, sich im Oktober zu gruseln, kann man in Altbayern und Tirol zwischen dem 21. Dezember und dem 6. Januar die Rauhnächte erleben: ein noch furchteinflößenderer Gruselspaß! Schreiend, röchelnd und rasselnd laufen die Perchtengruppen in sehr aufwendig gestalteten Kostümen und mit schauerlichen Fratzen durch die Lande und verbreiten Schrecken.
Ein echtes Erlebnis mit Gänsehautfaktor! Mehr über die Winterbräuche unter:
https://www.bayerischer-wald.de/Urlaubsthemen/Kultur-Kulinarik/Brauchtum
Wie das Sterben in Zeiten von Corona zum Medienthema wird.

Bild: #170326292 von parallel_dream – stock.adobe.com
Seit nahezu sechs Monaten beschäftigt uns alle ein Thema am allermeisten: Corona, oder COVID-19. Die aktuelle Situation, die Aussichten und der Umgang mit den sich einstellenden Umständen. Und: das sonst so gern verdrängte Thema Sterben. Auch in den Medien ist dies das vorherrschende Programm. Im Netz, im Radio und im Fernsehen.
Interessant ist die ZDF-Sendung „Aspekte on tour“ vom 14. August 2020 mit dem Thema „Endlich – ein neuer Umgang mit dem Sterben“. Oder auch mit dem Titel „Sterblichkeit in Zeiten von Corona“. Noch zu sehen in der ZDF-Mediathek.
„Die Begrenzung des Lebens, also der Tod, gehört zum Leben dazu. Das rückt in den jetzigen Zeiten wieder in unser Bewusstsein.“ In dieser „Aspekte on tour“-Sendung wird darüber gesprochen: über den Tod, den Weg dorthin und die Trauer der Angehörigen. In heutigen Zeiten. Das meint eben nicht nur in den letzten sechs Monaten, sondern in unserer heutigen Zeit allgemein. In der das Sterben durch den Einsatz hochmoderner Medizin mitunter lange dauern kann.
Zu Wort kommen der Palliativmediziner Matthias Gockel, Künstler wie die Geigerin Anne-Sophie Mutter und der Theaterregisseur Claus Peymann, die Initiatorinnen des Podcasts „endlich“ und andere.
Ein guter ZDF-Beitrag, der nicht erschreckt, sondern anregt, das Sterben und den Tod wieder mehr ins Leben zu holen. Ganz unabhängig von Corona.
Der Beitrag ist zu finden in der ZDF-Mediathek unter
www.zdf.de/sendung-verpasst.
The best way to spread love is to keep the distance.

Bild: #339281851 von THPStock - stock.adobe.com
So oder auch mit anderen Worten wie „zwei Meter Abstand bitte“ oder mit einfachen, mittlerweile tausendfach gesehenen Piktogrammen kann man die jetzige Zeit knapp zusammenfassen. Social distancing wohin man sieht.
Kaum ist die Krise etabliert, Masken und Abstand fast alltäglich, entstehen überall kreative Ideen mit dem Umgang sonst alltäglicher Situationen.
Bestatter haben mittlerweile oftmals mobile Plexiglasscheiben zur Hand und können damit nach einiger Gewöhnungszeit doch private Trauergespräche führen - in ihren Räumlichkeiten oder bei der Trauerfamilie zu Hause. Ohne Maske, mit Mimik und vertrauter menschlicher Nähe.
Auf Friedhöfen war zu Beginn der Corona-Krise sogar eine Trauerfeier mit Gästen unter freiem Himmel untersagt, an die Benutzung einer Kapelle war gar nicht zu denken. Mittlerweile sind die Vorgaben wieder etwas gelockert, mancherorts sind bis zu 50 Personen erlaubt, aber es gilt das Hausrecht. Die Entscheidung liegt bei der Friedhofsverwaltung. Der Aufwand des Hygienekonzepts, vor allem in geschlossenen Räumen, ist groß.
Und da ist die nächste kreative Idee: Online-Gedenk- und Trauerfeiern. Versprochen wird, dass alles, was man von einer realen Trauerfeier kennt, auch online zu erleben ist: ein Trauerredner, der nach vorheriger Abstimmung über den Verstorbenen spricht, ein Musiker, der die Lieblingsmelodie spielt. Und die Angehörigen, ein jeder zu Hause an einem Endgerät online dabei und sogar irgendwie miteinander Kaffee trinkend und in Erinnerungen schwelgend. Wie das geht, erklärt ein Video der Anbieterfirma Convela unter www.trauerfeier.online.
Vielleicht ist das, nachdem man sich ein wenig an den Gedanken gewöhnt hat und ein bisschen in Übung ist, gar keine schlechte Idee. Nicht nur in Zeiten der Krise, sondern auch für die ganz normalen Umstände einer Bestattung, denn so könnten auch weniger mobile Angehörige, im Ausland lebende Kinder oder Enkel mit dabei sein.
Ein Blick in die Zukunft? Wer weiß.
Was erwartet uns wohl nach dem Tod?

(Foto: AdobeStock #332394503 von dottedyeti)
Die Frage, was nach dem Tod kommt, stellen sich wohl alle Menschen - seit jeher. Kulturen und Religionen beschäftigen sich mit der Vorstellung des ewigen Lebens im Jenseits oder der Wiedergeburt im Diesseits.
Beim Christentum verlässt die menschliche Seele nach dem Tod den Körper. Der weitere Weg ist bestimmt durch die Gnade Gottes – je nach Glaube erwarten uns Himmel und Hölle.
Im Judentum ist die Totenruhe heilig und ewig. So dürfen die Körper der Toten nicht verbrannt und das Grab nicht mehrfach belegt werden, es ist auf ewig angelegt. Der Glaube, was nach dem Tod kommt, ist unterschiedlich: So glauben z. B. viele, dass alle Toten am Jüngsten Tag gemeinsam auferstehen.
Im Islam herrscht der Glaube an das Paradies und die Hölle – ganz nach irdischer Lebensart. Dem gottgefälligen Menschen erwartet das Paradies, ganz nah bei Allah. Dem von der Religion Abgewandtem die Hölle – detailreich beschrieben im Koran.
Wiedergeboren wird man im Glauben des Hinduismus, wenn es dem Gläubigen nicht gelingt, seine Einzelseele (atma) mit der Allseele (brahman) zu vereinigen, um so erlöst zu werden (moksha). Der Kreislauf der Wiedergeburt folgt ansonsten dem „Gesetz der Tat“ im irdischen Leben. Wer Gutes tut, wird gut – wer Böses tut wird z. B. als Wurm wiedergeboren.
Der Glaube der Buddhisten besagt, dass alle Menschen in einem Kreislauf aus Geburt, Tod und Wiedergeburt gefangen sind. Auch hier hängt die Qualität der Wiedergeburt vom vorherigen Leben ab. Den Zyklus (samsara) verlassen kann man über den „achtfachen Pfad“. Dieser formuliert Lebensformen wie Gewaltlosigkeit und Konzentration, um Frieden und innere Ruhe zu finden. Gelingt dies, kann man das nirvana erreichen – das Nicht-Sein.
Lebensverändernde Diagnosen

Bild: #102115534 von beeboys – stock.adobe.com
Zukunftsdialoge
Ausführlich sprechen Ärzte, statistisch gesehen, nur mit einem von drei Patienten, die eine lebensverändernde Diagnose bekommen. Die Bedeutung einer lebensbeschränkenden oder sogar den Tod voraussagenden Diagnose wird oftmals nicht in der ganzen Tiefe besprochen; individuelle Aussichten und Möglichkeiten nicht vielschichtig betrachtet. Es fallen immer wieder Worthülsen wie: austherapiert, unheilbar krank oder palliativ zu behandeln. Diese Worthülsen sind für Patienten schwer zu durchschauen. Vor allem bringen sie keinerlei Perspektive für die verbleibende Zeit.
Die Universität Harvard entwickelte genau für dieses Szenario einen Gesprächsleitfaden, den „Serious Illness Conversation Guide“ Diesen nutzen mittlerweile auch hiesige Ärzte, um schwierige Gespräche vor allem mit unheilbar kranken Patienten und den Angehörigen zu führen. Sie nennen die Gespräche „Zukunftsdialoge“, denn sie sind keine Arzt-Patient-Monologe, sondern wirkliche Dialoge, die den Betroffenen zu Wort kommen lassen und eine Perspektive ermöglichen, sei es für Tage, für Wochen oder Monate. Dies ist immens wichtig für eine verbleibende Behandlungsplanung, aber vor allem für die persönliche Lebensplanung. Und die Würde am Schluss.
Auszüge aus einem Leitfaden für den Zukunftsdialog:
1. Das Gespräch in Gang bringen.
Fragen Sie den Patienten und auch die Angehörigen danach, was ihnen wichtig ist, was sie wissen möchten.
2.Verständnis und Wünsche beurteilen.
Fragen Sie den Patienten nach seinem Wissensstand. Erklären Sie offen und verständlich.
3. Prognosen teilen.
Fragen Sie konkret nach den Wünschen, Hoffnungen und Sorgen der Patienten. Sprechen Sie klar aus, ob und welche Prognosen gestellt werden können.
4. Ziele, Ängste, Sorgen und Aussichten besprechen.
5. Das Gespräch aktiv beenden.
Fassen Sie den Dialog zusammen und geben Sie eine konkrete Empfehlung.
6. Dokumentieren Sie das Gespräch.
Jetzt ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge.

Bild: # 301894830 von - naturaleza stock.adobe.com
So definiert die Bundeskanzlerin den Begriff Fürsorge, aus aktuellem Anlass.
Gibt man dieser Tage den Begriff Fürsorge in die Suchmaschinen ein, erscheint ganz oben auf der Liste die Rede an die Nation von Frau Merkel vom 18. März 2020, gefolgt von Wikipedia, welches folgende Definition anbietet:
„Fürsorge bezeichnet die freiwillig oder gesetzlich verpflichtend übernommene Sorge für andere Personen oder Personenvereinigungen.“
Vielleicht ist ja jetzt die Zeit gerade über solche Begriffe wie Fürsorge zu sinnieren und einmal zu benennen, wer sich ihrer inhaltlich annimmt. Trennt man den Begriff, erhält man „Für“ und „Sorge“. Der erste Wortteil also Verbunden mit einem Startpunkt und einem Ziel: ein oder mehrere Menschen für einen oder mehrere andere. Der zweite Wortteil, Sorge haben oder tragen, als vorrauschauende Verantwortung für ein mögliches Geschehen: z. B. eine Krankheit, eine menschliche oder wirtschaftliche Notsituation: ein oder mehrere Menschen für einen oder mehrere andere.
Der Beruf des Altenpflegers, des Sozialarbeiters, der Krankenschwester, des Arztes* und eben auch der des Bestatters haben sich genau dies zur Profession gemacht: Fürsorgen! Von Mensch zu Mensch.
Dafür heute einmal: Danke!
*und natürlich viele mehr
Wo und wie will man sterben?

Bild: #246269779 von Thomas Reimer - stock.adobe.com
Jeder vierte Deutsche würde am liebsten im Hospiz sterben.
Das ergibt die Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des Deutschen Hospiz- und Palliativerbandes (DHPV) 2017.
Hiernach ist die Zahl der Menschen, die zu Hause sterben möchten in den letzten Jahren auf 58% gestiegen. Die Zahl derjenigen, die in einem Hospiz die letzten Tage verbringen möchten auf 27%. Seit der hitzigen Bundestagsdebatte über organisierte Sterbehilfe und der beschlossenen Stärkung der Hospiz- und Palliativversorgung (bereits in 2016), ist der Umgang mit dem Thema Sterben in unserer Gesellschaft wesentlich offener und selbstbewusster geworden. Viele Menschen haben eine Vorstellung über das „Wie“ und „Wo“. Das brandaktuelle Urteil des BGH vom 25.02.2020 besagt, dass jeder Mensch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben hat. So darf die Frage nach dem „Wie“ bei unheilbar kranken Menschen wieder neu gestellt werden.
Das „Wo“: Hier klaffen Wunsch und Wirklichkeit nach wie vor weit auseinander. Gerade einmal 23% der Befragten, die angegeben haben zu Hause sterben zu wollen gelingt dies auch. 4% der Befragten haben angegeben im Krankenhaus sterben zu wollen; tatsächlich sind es 58% im Jahr 2017. Hospize, ambulante Hospizdienste und Palliativstationen könnten hier helfen – aber das Angebot reicht bei weitem nicht aus, der Bedarf ist zu groß.
Das „Wie“: Der Anteil derjenigen Bürger, die über eine Patientenverfügung verfügen, ist von 26 % in 2012 auf 43% in 2017 gestiegen. Tendenz steigend. Auch hier klaffen Wunsch und Wirklichkeit auseinander, ist in der Patientenverfügung nicht detailliert festgelegt, was genau z.B. lebensverlängernde Maßnahmen sind, so kann diese Verfügung laut einem Urteil des BGH wirkungslos sein. Im Urteil des BGH wurde nun klargestellt, dass einzelne medizinische Maßnahmen konkret benannt werden müssen.
Eine gute und intensive Beratung in Sachen „Wie“ und „Wo“ sind ratsam, denn das hat das Leben verdient.
Quelle: DHPV www.dhpv.de
Bundesjustizministerium: www.bmjv.de, Vorsorge und Patientenrecht
Erste Hilfe für die Seele

Bild:#60500575 von benjaminnolte - stock.adobe.com
Wenn die Not besonders groß ist, die Hoffnung erlischt und Menschen emotionale Grenzerfahrungen z.B. nach einem plötzlichen Unfalltod eines nahen Angehörigen machen, ist die Notfallseelsorge zur Stelle. Ganz einfach so, nach Bedarf.
Die Notfallseelsorge in Deutschland ist ein gut funktionierendes, flächendeckendes System, das Menschen in Notsituationen unkompliziert professionelle Hilfe anbietet. Ausgebildete Seelsorger sind in der Regel Pfarrerinnen und Pfarrer der christlichen Kirchen, aber auch besonders ausgebildete ehrenamtliche Mitarbeiter. Sie sind über die örtliche Polizei und den Rettungsdienst erreichbar und werden oft von den jeweiligen Dienststellen hinzugerufen. So stehen sie parat, wenn es gilt, die traurige Nachricht eines Unfalltodes an die Angehörigen zu übermitteln. Denn „wie“ eine solche Nachricht überbracht wird, ist ausschlaggebend für die gesamte kommende Trauerzeit und die Trauerverarbeitung.
Notfallseelsorger bringen Zeit mit, viel Zeit. Sie haben Geduld, ein hohes Maß an Empathie und vermitteln so den Angehörigen: „Sie sind nicht allein.“ Ziel ist es, einer seelischen Traumatisierungen vorzubeugen.
Die Seelsorger stehen solange vor Ort zur Verfügung, bis andere Unterstützung, zum Beispiel durch die Familie, eintrifft und die Betroffenen versorgt sind.
Die Notfallseelsorge arbeitet nach den Standards der anerkannten Krisenintervention (Leitlinien psychosoziale Notfallseelsorge Deutschland) und auf Basis des christlichen Verständnisses von Seelsorge.
Erste Hilfe für die Seele – eine gute Sache!
Andere Länder, andere Sitten.

Bild: #89112137 von Photocreo Bednarek - stock.adobe.com
„Gut sterben“ heißt ein Programm eines Heilzentrums in Seoul, Südkorea. Das Skurrile: Es geht nicht darum, Palliativ-Patienten die Angst vor dem Unausweichlichen zu nehmen, sondern darum, gesund und munter einen neuen Blick auf das Leben zu bekommen. Menschen aller Altersstufen sind angesprochen, sich mit der Situation „Sterben“ bekannt zu machen. Das Ziel: einen neuen, positiven Blick auf das Leben zu entdecken.
Neben dem Schreiben eines Testaments, dem Nähen eines Totenhemdes und dem Erstellen eines Trauerbildes ist auch ein 10-minütiges Probeliegen in einem geschlossenen Sarg Inhalt des Kurses.
Mehr als 25.000 Menschen sollen seit der Eröffnung im Jahre 2012 an dieser Veranstaltung teilgenommen haben. Positive Resonanz gibt es wohl von Jung und Alt.
Veranstaltet werden diese Seminare auch von Mönchen und Bestattungsinstituten. Hierzulande kann man auf YouTube* mal einen Blick riskieren auf: andere Länder, andere Sitten.
*Video unter der Überschrift: Sterben für ein besseres Leben in Südkorea.
Spielzeug für trauernde Kinder?

Bild: #176964480 von tampatra - stock.adobe.com
In Kooperation mit LEGO® hat der niederländische Trauerpädagoge Richard Hattink Bestattungsspielzeug für Kinder entwickelt. Die Idee dahinter: spielend mit den Themen Tod und Trauer umgehen.
Das Spielzeug kann nicht über LEGO® direkt bezogen werden, denn es ist ein therapeutisches Spielzeug, das einer „Spiel-Begleitung“ bedarf. Psychologen, Pädagogen und auch Bestatter beziehen es entweder online über www.bestattungsspielzeug.com oder aber im Bestattungsmuseum des Wiener Zentralfriedhofs: www.shop.bestattungsmuseum.at
Eine kleine Kirche, Träger mit Sarg und auch ein Miniatur-Friedhofsareal mitsamt Spielzeug-Bagger lassen das Thema Bestattung weniger bedrohlich wirken. In Kitas und Grundschulen ist das Thema Tod oftmals eine pädagogische Lerneinheit, um Lebensalltag erfahrbar zu machen. Das Spielzeug kann den Kindern helfen, einen Ausdruck für ihre Gefühle zu finden und Abläufe besser zu verstehen. Situationen nachzuspielen, ist vor allem bei kleineren Kindern ein normales Verhalten im Verarbeitungsprozess, so auch bei den Themen Trauer und Tod.
Ob der Krematoriumsofen und der grimmig dreinschauende Mitarbeiter unbedingt mit von der Partie sein müssen, mag der zuständige Therapeut oder Pädagoge entscheiden.
„Friedhof 2030“

Bild:#16401086 von Glenda Powers - stock.adobe.com
Eine Initiative des Kuratoriums Deutsche Bestattungskultur und des Bundesverbandes Deutscher Bestatter e.V.
Ihre Meinung ist gefragt: Die Initiative Friedhof 2030 beschäftigt sich mit der kulturellen Entwicklung des Trauerortes „Friedhof“. Die Erhaltung kultureller Werte, der Schutz historischer Bestände und die sich ändernden Bedürfnisse der Gesellschaft heute stehen im Mittelpunkt.
Die Initiatoren von Friedhof 2030 fordern von Friedhofsverwaltungen, Städten und Kommunen und auch Kirchen ein wesentlich kreativeres und engagierteres Vorgehen als in der Vergangenheit. Ein „Weiter so“ wird das schon viel diskutierte Sterben der Friedhöfe nicht aufhalten können.
Aber diesmal ist auch die Meinung der Bürger gefragt, denn die Hinterbliebenen und Nutzer von Friedhöfen gestalten sie wesentlich mit: die deutsche Bestattungskultur. Auf der Website von Friedhof 2030 wird Ihre Meinung explizit erfragt. Und es gibt sehr viele Informationen über kreative Ideen, Friedhöfe am Puls der Zeit zu gestalten.
Praxisbeispiele, Vorträge und auch eine Initiative, die deutsche Friedhofskultur in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufzunehmen, finden sich auf der Website.
Obwohl die Bestattungskultur und die Gestaltung der Friedhöfe gerade bei uns in Deutschland vielfältig sind und es besondere regionale Ausprägungen zwischen Nord und Süd und Ost und West gibt, wird es dennoch Zeit, die Zukunft zu planen.
Damit Friedhöfe nicht aussterben und die Geschichten der Menschen und der Gemeinden mit ins Grab nehmen.
Ein Blick auf die Website der Initiative Friedhof 2030 lohnt sich!
www.friedhof2030.de
Ein Fest zu Ehren!

Bild:#43744241 von Pierre-Yves Babelon - stock.adobe.com
Museum für Sepulkralkultur Kassel
Tagelang wird gefeiert, gesungen und getanzt.
Trauerfeiern im afrikanischen Ghana sind bunt, fröhlich und lautstark.
Die Angehörigen, und oft das ganze Dorf, feiern den Toten und das, was ihn ausmachte.
Und das ist sichtbar: Die Ausstattung der Trauerfeier ist oft sehr opulent, es wird an nichts gespart. Nirgendwo sonst sieht man so ungewöhnliche Särge wie in Ghana. Sie drücken aus, was der Verstorbene liebte, was er tat oder wofür er schwärmte. So sind Särge in Form eines Fisches, eines Hobels oder eines Flugzeuges keine Seltenheit.
Je liebevoller, detailreicher und großzügiger die Ausstattung der Feier, desto größer das Ansehen der Familie in der Gemeinde und – wichtig - im Ahnenreich. Die geliebten Verstorbenen sollen eben in diesem gut ankommen, und eine positive Verbindung zwischen den Lebenden und den Ahnengeistern schaffen und für gute Stimmung sorgen. So fallen die Lebenden nicht in Ungnade.
Diesen Totenkult gab es nicht schon immer im eher christlich geprägten Ghana. Erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts beginnt er sich zu etablieren – Bestattungskultur im Wandel, auch in Afrika.
All dies kann man sich anschauen im Museum für Sepulkralkultur in Kassel. Die Ausstellung „Mit dem Linienbus ins Jenseits.“ INTERVENTION, Martin Wenzel. SÄRGE UND URNEN“ ist vom 10. August bis 13. Oktober 2019 zu sehen. Ein Bericht des ZDF heute journal vom 12. August 2019 dazu findet sich in der Mediathek des ZDF.
Weitere Informationen unter: www.sepulkralmuseum.de
Wenn die Gießkanne schwerer und schwerer wird.

Bild: #230814150 von Little Adventures - stock.adobe.com
Das kennt wohl jeder: Die Sonne lacht, Regen ist weit und breit nicht in Sicht. Leider auch nicht der nächste Wasserhahn auf dem Friedhof. Geschweige denn ein Wassersystem, was den kleinen „angelegten Garten“ versorgen würde. Besonders älteren Personen fällt es schwer, das schön gestaltete Erdgrab ausreichend zu bewässern. Zu schwer sind die Gießkannen, zu weit ist der Weg bis zum nächsten Wasserhahn.
Ein paar Tipps und Do-it-yourself-Systeme aber können zumindest den täglichen Gang auf den Friedhof bei 30 Grad plus entlasten:
Bewässerung durch einfache PET-Wasserflaschen: Stecken Sie mehrere Flaschen (je größer, desto länger die Wirkung) kopfüber in das Beet. Der Deckel sollte draufgeschraubt bleiben und mit Löchern versehen werden. So kann das Wasser dosiert in der Erde versickern. Von Zeit zu Zeit muss der Deckel evtl. gereinigt werden. Etwas Kies in das Loch, in das die Flasche gesteckt werden soll, hilft, damit der Deckel nicht verstopft. Im Fachhandel gibt es auch extra Verschlüsse, die auf handelsübliche PET-Flaschen aufgeschraubt werden können.
Tontöpfe als Wasserspender: Ebenso unkompliziert und dazu gut aussehend ist die Bewässerung mit Tontöpfen, die schräg in die Erde gesetzt werden. Das Bodenloch des Topfes mit einer Tonscherbe bedecken, so dass nur an wenigen Stellen das Wasser durchsickern kann. Die Töpfe randvoll gießen.
Wasserspender mit Saugschlauch: Im Gartenhandel erhältlich sind Ton- oder Keramikkegel, die mit einem dünnen Schlauch verbunden sind und bei Austrocknung des Kegels automatisch Wasser aus einem Gefäß ziehen. Dieses Gefäß kann ein gefüllter Eimer oder eine Gießkanne sein, die z. B. hinter dem Grabstein oder unter einem höheren Busch versteckt stehen kann.
Wasserspeichermatten oder Wasserspeichervliese: Sie werden am besten direkt vor dem Einpflanzen der vor allem einjährigen Pflanzen wie z. B. Tagetes unterhalb der Wurzeln im Beet verteilt. Aber auch im Nachhinein kann an freien Stellen die Erde etwas angehoben und ein Vliesstück daruntergelegt werden. Beim Gießen saugt sich das Vlies automatisch voll und gibt die Feuchtigkeit wieder ab. Ein zu dicht gelegtes Vlies kann allerdings bei Regen einen Feuchtigkeitsstau erzeugen.
Last, but not least: Achten Sie auf Pflanzen, die auch Trockenheit gut überstehen! Ihre Friedhofsgärtnerei berät Sie gerne.
Bucket List oder: Gas geben, bevor es zu spät ist.
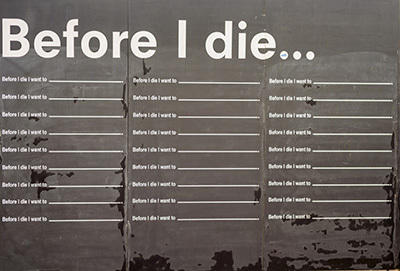
Bild: #182534308 von Clement – stock.adobe.com
Was wollen Sie eigentlich noch erreichen oder einfach nur erleben? Die „Bucket List“ ist in aller Munde, eine Art Wunsch- oder „to-do“-Liste für den Rest der verbleibenden Zeit – ab jetzt!
An Traumorte reisen, eine Fremdsprache lernen, an einer Demo teilnehmen und verhaftet werden, im Netz neue Bekanntschaften schließen, nackt baden, einen Flugschein machen, ein Abenteuer erleben, weniger arbeiten und den Garten nach Yin-Yang umgestalten und genießen? Die Antwort auf die Frage dürfte vielfältig und sehr persönlich sein. Was für den einen ein Abenteuer ist, ist für den anderen Alltag.
Der Begriff „Bucket List“ kommt aus Amerika und geht auf die Redewendung (frei übersetzt) „kick the bucket“ – den Löffel abgeben zurück. Es geht also um Dinge, die man tun sollte, bevor man den Löffel abgibt. Eigentlich ist das nichts Neues, doch fängt das „Bevor“ heute eher an – und das ist gut!
Für die „1000 Plätze, die man sehen muss, bevor man stirbt“* benötigt man sicher mehr als ein paar Monate und warum überhaupt erst gegen Ende mit dem Abarbeiten der „to-do“-Liste anfangen? Dieser Einstellung folgt auch Nelly Furtado in ihrem Song „Bucket List“. Der Film „The Bucket List“ mit Morgan Freeman und Jack Nicholson aus dem Jahr 2007 ist dramatisch, amüsant und sicher überzogen und trifft doch den Punkt: Machen, so lange man kann!
Also, bevor Sie den Löffel abgeben – und besser lang, bevor Sie den Löffel abgeben:
Leben Sie!
„Woher weiß der Tod denn, wo er hinkommen soll?“

Bild: #18959340 von Ella – stock.adobe.com
Kinder sind von Natur aus neugierig und interessiert. Dem Thema Tod begegnen sie oft bereits im Kindergartenalter, z. B. wenn die Oma oder der Opa des Kindergartenfreundes stirbt.
„Sterben tun doch nur andere, oder?“ Das ist die naive Vorstellung, die erst erschreckend weicht, wenn die eigenen Großeltern oder andere, dem Kind nahestehende und geliebte Menschen, versterben.
Vielleicht ist es da besser, gar nicht erst auf die Schrecksituation zu warten. Das Thema Tod ist facettenreich: der tote Käfer auf dem Balkon, die tote Maus im Garten oder der verstorbene nette Nachbar von nebenan. Die Kinderfragen dazu sind oft skurril und beschäftigen sich vielmals mit ganz profanen Dingen: „Wer mäht denn jetzt den Rasen von Herr Suder?“
Diese unbefangene Art ist der beste Moment, sich dem Thema Vergänglichkeit zu widmen. Im Gespräch, beim Vorlesen eines Kinderbuches oder beim Besuch eines Theaterstücks.
„Ente, Tod und Tulpe“ von Wolf Erlbruch zum Beispiel wird gerade von einer Dortmunder Theatergruppe auf die Bühne gebracht – im Familientheater sonntags um 11 Uhr.
Kinder ernst nehmen und teilhaben lassen. Das sind die Beweggründe für gute Trauerliteratur und Trauertheater für Kinder.
Bestattungshäuser – mittendrin im Leben
Zwischen Kiosk und Friseur

Bild: #174344838 von Africa Studio - stock.adobe.com
Oft findet man sie in ganz normalen Wohnstraßen, zwischen einem Kiosk und einem Friseur und neben einer Physiopraxis: die Bestattungshäuser oder Bestattungsinstitute und auch nur den Bestatter.
Manchmal laden die Schaufenster sogar zum Verweilen ein, denn sie sind immer öfter schön gestaltet und im besten Fall halten sie auch noch interessante Informationen bereit. Spätestens nach der ersten Verwunderung schauen wir es uns an – das Bestatter-Schaufenster.
Und durch das Schaufenster sehen wir: Die Räumlichkeiten eines Bestatters haben nicht mehr eine düstere Totengräberstimmung alter Zeiten auf Lager. Sie sind hell und modern gestaltet und wir treffen eher sehr lebendige und freundliche Menschen, die gerne ein Gespräch mit uns führen.
Denn der Bestatter mag es auch gerne lebendig, ist er doch vor allem für die Hinterbliebenen der Ansprechpartner, Berater, Tröster und versierter Organisator für ein Thema, dem wir oft kopflos begegnen. Ein Allrounder der besonderen Art.
Der Bestatter von nebenan ist erfahren und hoffentlich „up to date“, denn die Möglichkeiten einer Bestattung und damit der zu beobachtende Wandel der Bestattungskultur liegen auch in seiner Hand. Seine Beratung und sein Engagement sind ausschlaggebend für die Abschiede, die gefeiert werden − heute oft wieder viel bewusster als noch vor 10 Jahren, detailfreudiger, persönlicher und zum Erinnern schön!
Ein guter Gedanke für die, die einen Bestatter oder einen Berater, Tröster oder Abschieds-Organisator aufsuchen müssen oder wollen.
Mittendrin im Leben, zwischen Kiosk, Friseur und Physiopraxis.
Am Ende auch für die Zukunft

Bild:#72712379 von peterschreiber.media - stock.adobe.com
Laut einer Umfrage der Aeternitas e.V. − Verbraucherinitiative Bestattungskultur vom März 2016 finden 54 Prozent der Bundesbürger ökologische Aspekte bei einer Bestattung wichtig. Ein guter Ansatz, wenn man über Nachhaltigkeit am Lebensende diskutieren möchte.
Nachhaltigkeit auf dem Friedhof?
Ein Sarg-Erdgrab benötigt im Schnitt 3,5 Quadratmeter Boden. Hinein kommt ein Holzsarg inklusive aller metallischen Verbindungen wie Wellennägel, Griffe und Schrauben, Leim, Farbe und Lacke und Kunstfasern der Innenausstattung. Die Friedhofssatzungen regeln vor allem die Umweltverträglichkeit in Bezug auf den Schutz des Grundwassers im Umkreis und selbstverständlich dürfen nur zerfallende Materialien genutzt werden. Dass dies schon allein für die Metallverbindung der Särge nicht zutreffend ist, ist den weiteren Anforderungen zuzuschreiben: Särge müssen schlichtweg halten. Für Urnen gelten die gleichen Bedingungen – Kunststoffmaterialien sind verboten.
Nachhaltigkeit unter Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und sozialer Gesichtspunkte?
Leider Fehlanzeige − bis auf das wichtige Thema „Grabmale aus Kinderarbeit“, das im jüngsten Bestattungsgesetz von 2014 geregelt ist und das Aufstellen von Grabmalen verbietet, die nachweislich mit Kinderarbeit produziert wurden. Der ökologische Unsinn des Imports von Grabsteinen aus aller Welt und von Billigsärgen aus Osteuropa wird nicht näher kommentiert. Eine Feuerbestattung kann nur mit hochmodernen Kremationsöfen und Energiekonzepten der Zukunft wie Solarstrom etc. annähernd umweltschonend sein. Welches Krematorium ist wie aufgestellt?
Grün leben – grün sterben: Worauf kann man achten?
Wem das Thema Nachhaltigkeit am Herzen liegt, der kann auch in Sachen Bestattung einiges tun: Fragen Sie nach und lassen Sie sich belegen, ob das Holz des Sarges aus der Region kommt und von nachhaltig arbeitenden Forstbetrieben geliefert wird. Ist die Sargproduktion ökologisch, werden naturfreundliche Substanzen bei der Verarbeitung genutzt? Ist die Innenausstattung wie die Decke und das Kissen aus Naturmaterialien? Gehört das beauftragte Krematorium zu den modernen zertifizierten Betrieben? Und, und, und.
Fragen Sie Ihren Bestatter!
01.06.2015
Wenn der Tod da ist, kommt die Trauer!
Denn sie ist die Konsequenz aus Liebe, Verbundenheit und gemeinsamer Vergangenheit.
Solche Worte liest man eher selten. Genau wie man selten etwas über den Tod, die Trauer, die Zeit danach, Tränen, Wut und Depression liest ‒ es sei denn in der Fachliteratur oder in der Sonderausgabe der Zeitung an Fronleichnam. In der alltäglichen Kommunikation tauchen diese Themen selten auf.
Tod und Trauer haben in unserer Kultur ihren festen und vor allem sichtbaren Platz verloren. Der schwarze Knopf am Revers eines Witwers, die schwarze Kleidung der Witwe für mindestens ein Jahr sind passé. Uns eher unangenehm berührende Szenarien wie lautes Klagen und Weinen oder auch fröhliches Abschiednehmen anderer Kulturkreise stehen ganz im Gegensatz zu unserem Umgang mit dem Tod, dem Abschied und der bleibenden Trauer. Trauer ist bei uns vor allem Privatsache!
Aber Trauer ist auch fast immer ein Zustand, den mehrere Personen gleichzeitig erleben, denn der verstorbene Ehemann war auch Bruder, Vater, Freund, Nachbar oder Vereinsmitglied. Er hinterlässt ein soziales Netz von Trauernden. Hier können wir uns ausdrücken und austauschen. Denn es tut gut zu erfahren, dass man nicht allein ist. Die gemeinsame Erfahrung hilft, sich auf ein Leben danach einzustellen. Den Verlust in seine Lebensgeschichte einzubauen und dem Verstorbenen weiterhin einen Platz zu geben. In heutigen Zeiten haben auch alleinstehende und zurückgezogen lebende Menschen ein Trauernetz, wenn sie es benötigen. Der Bestatter ‒ oft auch Trauerbegleiter und eine Art Seelsorger ‒und andere professionelle Einrichtungen ersetzen hier so gut es geht das familiäre Umfeld.
Was dennoch bleibt: Trauer ist ein sehr unangenehmes, schmerzhaftes Gefühl, das selten ganz verschwindet. Aber ohne dieses Gefühl könnten Menschen keine Beziehungen eingehen ‒ und alles wäre gleich! Oder: Wer A sagt, muss auch B sagen.
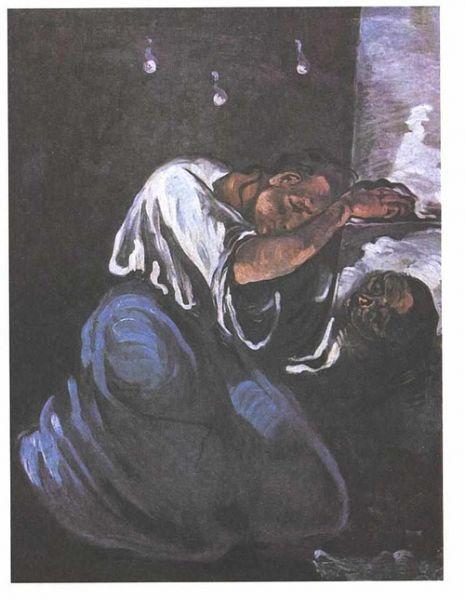
Bild: Wikimedia - „Cezanne ‒ Der Schmerz“ von Paul Cézanne ‒ repro from art book - gemeinfrei
11.05.2015
Vom Marienmond, Christi Himmelfahrt und dem Heiligen Geist!
Im Wonnemonat Mai tummeln sich im Jahr 2015 die wichtigsten Hochfeste der katholischen und evangelischen Kirche.
Die katholische Kirche verehrt im Mai die Gottesmutter Maria. Die Bezeichnung Marienmond ist altertümlich und heute weniger bekannt. Das Bild, das die Evangelien von Maria zeichnen, ist geprägt von der Absicht der Verkündung Jesu Christi. Also eine vorgeburtliche Geschichte, aber zentraler Schauplatz des Christentums.
Christi Himmelfahrt ist das katholische und evangelische Fest der Aufnahme Jesu Christi an der Seite Gottes. Die Thronbesteigung neben dem Heiligen Vater wird 40 Tage nach Ostern gefeiert. In früheren Zeiten gab es vielerorts festliche Himmelfahrtsprozessionen, die sich heutzutage zum Herren- oder auch Vatertag gewandelt haben und regional sehr unterschiedlich gefeiert werden. In den Kirchen jedoch gehört ein festlicher Gottesdienst nach wie vor zum schönen Brauch. Die biblische Grundlage findet man u. a. im ersten Kapitel der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Dort steht, dass der nach seiner Kreuzigung vom Tod auferstandene Jesus Christus noch 40 Tage zu seinen Jüngern sprach. Am 40. Tag wurde er in den Himmel emporgehoben und verschwand in einer Wolke. „Eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken“ (Apostelgeschichte 1,9).
Nur 10 Tage später und 50 Tage nach Ostern feiert die Kirche Pfingsten. Es ist das Fest des Heiligen Geistes und somit die Vervollständigung der göttlichen Dreifaltigkeit: Gott, der Vater, Jesus, der Sohn, und der Heilige Geist. Diese Gestalt Gottes ist sicher die unwirklichste und am wenigsten greifbare. Denn die Theologen sehen den Heiligen Geist als jemanden , der die Worte und das Wirken Jesu Christi für die Menschheit aufrechterhalten soll. Diese Geistessendung war der Ausgangspunkt der Mission der Jünger Jesu und wenn man so will, die Geburtsstunde der heutigen Kirche. Die Kirche nun als verlängerter Arm der Dreifaltigkeit zur Lebendighaltung und Erinnerung an die Worte Jesu Christi . Pfingsten gehört sowohl für die katholische als auch für die evangelische Kirche neben Weihnachten und Ostern zu den größten Kirchenfesten des Jahres.
Auch in 2016 und 2017 versammeln sich diese hohen Feste im Wonnemonat Mai und bescheren uns neben den religiösen Brauchtümern auch noch ein paar hoffentlich sonnige freie Tage!

Bild: Wikimedia - Neithan90 - cc0 by 1.0















